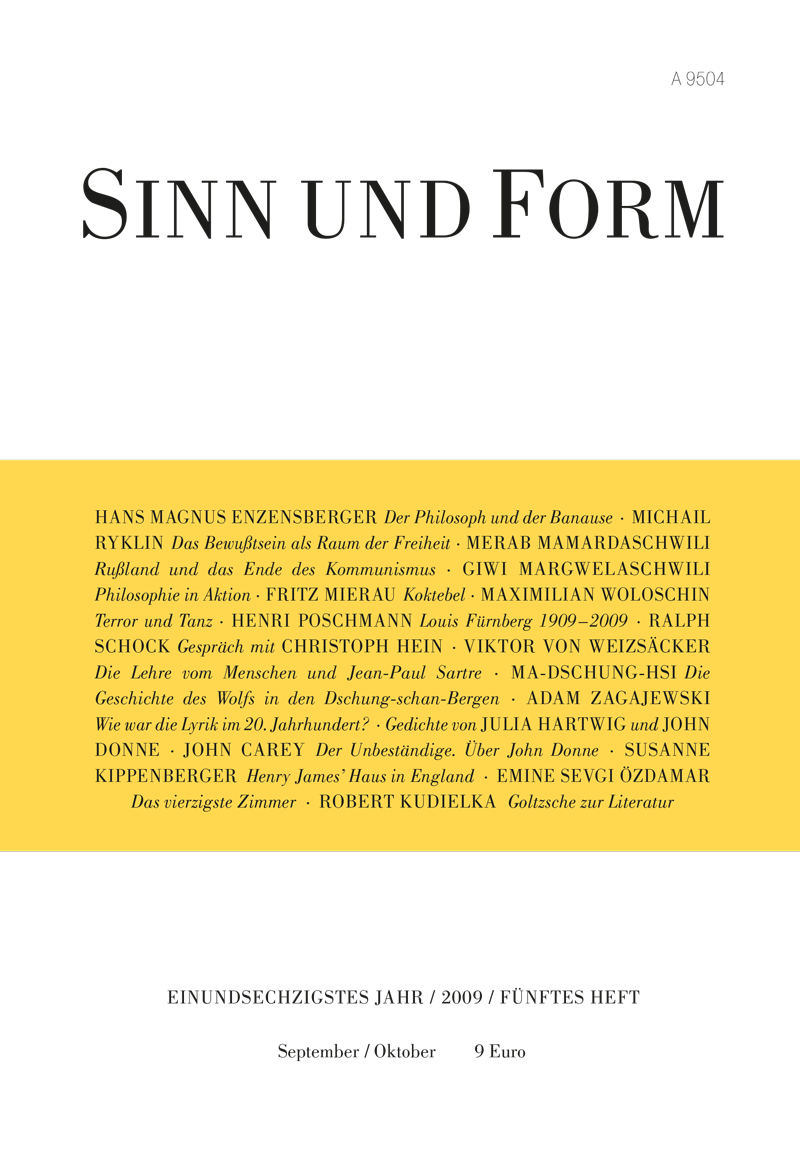Leseprobe aus Heft 5/2009
Mierau, Fritz
Koktebel - Blaues Siegel oder Erfindung einer Landschaft
Vor vierzig Jahren überwältigte mich der Anblick einer Küstenlandschaft am Schwarzen Meer. Auf meiner russischen Reise vom Sommer 1965 hatte ich den Osten der Krim erreicht: Homers Kimmererland, Kolonie von Milet, später von Genua, vor der Eroberung durch Rußland Chanat der Tataren, Hitlers geträumten »Gotengau«, heute Ferienparadies und gepriesene Weingegend der ukrainischen autonomen Republik Krim.
In einer Bucht erhob sich unmittelbar am Meer vor dem Hintergrund schroffer kahler Berge ein Steinbau mit hohen Fenstern im Stil einer frühchristlichen Basilika. Seitlich Balkons, daran Holztreppen, die bis hinauf zu einer Dachterrasse führten. Angelehnt ein paar bescheidenere niedrige Gebäude. Bänke im umliegenden Gärtchen. Zwar hoffte ich dieses Anwesen zu finden, das in Rußlands Künstlerkreisen legendären Ruhm genoß, ahnte aber nichts von seiner Gestalt. Beschreibungen kannte ich, vor allem die Ilja Ehrenburgs, dessen Memoiren ich damals übersetzte. Doch das Beieinander, das Gegeneinander von Meer, häuslich umarmtem Sakralbau und vulkanischem Fels traf mich unvorbereitet in dem Licht des südlichen Vormittags.
Neben den Quartieren der Sommerfrischler, den Holzhäusern der Weinbauern und den Kunststoffbaracken einer Stolowaja für die Verpflegung der »Wilden«, der Zeltnomaden, wirkte der Bau am Meer wie ein Relikt aus fernster Zeit und schien die Würde der alten Genueserfestung auszustrahlen, deren Ruine ich auf meinem Weg hierher passiert hatte.
Die russische Geistesgeschichte kennt den Ort als Koktebel und den Mann, der ihn berühmt machte, »fand«, gar »erfand«, als den Dichter und Maler Maximilian Woloschin. »Erfand« im alten Verstande von entdecken und ersinnen in einem, wie das Goethe begriff: »Alles, was wir Erfinden, Entdecken im höheren Sinne nennen, ist die bedeutende … Bethätigung eines originellen Wahrheitsgefühls … Es ist eine aus dem Innern ans Äußere sich entwickelnde Offenbarung, die den Menschen eine Gottähnlichkeit vorahnen läßt. Es ist eine Synthese von Welt und Geist.«
Von den Winden der Jahrtausende sah Woloschin sich den Bergen in einer Weise eingeschrieben, daß er im Felsvorsprung von Kok-Kaj sein Profil vorgebildet wähnte. Nach Jahren in St.Petersburg, Moskau und Paris hatte er sich lange vor dem Ersten Weltkrieg hier angesiedelt, am alten Karawanenweg von Asien nach Europa seine eigene Karawanserei bauen lassen und dabei tischlernd selbst mit Hand angelegt: Koktebel erschien ihm als der Ort, der ihm und dem er bestimmt war.
Tatsächlich ist Woloschins Leben in Koktebel einem Anschmiegen an das Wirken der Elementarkräfte verglichen worden. Ossip Mandelstam erzählt, wie ihm ein Zimmermann Woloschins Grab zeigte, das hoch in den Bergen des Karadag über dem linken Ufer der Iphigenie-Bucht liegt. Als sie Woloschins sterbliche Überreste an den Ort trugen, den der Dichter im Testament bestimmt hatte, seien alle von der weiten Rundsicht überrascht gewesen, die sich ihnen von da über Meer, Berge und Steppe eröffnete. Allein Maximilian Alexandrowitsch habe den Blick für diesen Ort besessen. »Der Zimmermann«, so Mandelstam, »trug ein Stemmeisen deutschen Fabrikats bei sich. Einmal tauchte er es in seine Nägel. Herausgezogen, war der nackte blaue Stahl berauscht von an ihm klebenden winzigen Eisenmücken.
So auch hat Maximilian Alexandrowitsch – Kustos einer wunderbaren geologischen Zufallsbildung namens Koktebel – aus freien Stücken sein ganzes Leben der Magnetisierung dieser ihm anvertrauten Bucht gewidmet.«
Der Empfang
Der Empfang im Haus am Meer war höchst zeremoniell und von feierlicher Strenge.
Wen ich treffen würde, wußte ich nicht. Es war ein Besuch auf gut Glück. Ich besaß lediglich einen Empfehlungsbrief an den achtzigjährigen Professor Iwan Pusanow, einen Biologen, intimen Kenner der Krim, seinerzeit Bekannter Woloschins, den ich in Odessa nicht erreicht hatte, was nun in Simeïs, wenige Kilometer vor Jalta, nachgeholt werden sollte, aber auch mißlungen war; in dem Schreiben wurde ich als »interessiert an Gumiljow, Woloschin und den anderen Dichtern vom Vorabend der Revolution« vorgestellt.
Nachdem ich mich in der Kunststoffbaracke an Quark, Milch, Tomaten, Gurke, Brot und Boulette mit Kartoffeln gelabt hatte, setzte ich mich draußen vor dem Haus des Dichters auf eine Bank in den Schatten der Akazien. Zu einem jungen Mädchen, Lenin-Pionierin, dem roten Halstuch nach zu urteilen. Maria Stepanowna sei nicht sehr gesund, sagte sie gleich. Gestern sei ihr nicht gut gewesen. Man müsse das Schlimmste befürchten. Sie ruhe im Augenblick noch. So erfuhr ich erst, daß Maria Stepanowna Woloschina, die zweite Frau des Dichters, lebte und wie die Jahrzehnte zuvor die Hüterin des Hauses war. Sie mußte Ende Siebzig sein. Von sich erzählte das Mädchen, sie sei zur Erholung in Koktebel und nutze die Gelegenheit, Woloschins Gedichte zu lesen und abzuschreiben. Gegen elf ging sie hinein. Ich sollte nach einer Weile folgen.
Empfangen wurde ich im Atelier, dem Raum mit den hohen Fenstern. An der Fensterfront hinter einem langen Tisch eine Frau und zwei Männer, stehend. An einem Pult die junge Verehrerin des Dichters. Erwartungsvolle Blicke: Woher kommst du, Fremdling? Wer bist du? Und was ist dein Begehr?
Ich war der erste Deutsche, der nach der Besetzung durch Hitlers Wehrmacht dort auftauchte, und vermutlich der erste Westeuropäer, der nach dem Besuch der englischen Malerin Violet Hart im Sommer 1907 das Haus des Dichters betrat. Johannes von Guenther, der Münchner Essayist und Übersetzer, ein Vertrauter und Nachdichter der russischen Symbolisten, der auch mit Woloschin verkehrt hatte, war nie hier gewesen. Im zweiten Weltkrieg hatte Maria Stepanowna das Haus vollkommen ausgeräumt und alles vergraben. Niemand von der deutschen Besatzungsmacht erfuhr etwas vom Geist und Vermächtnis des Dichters.
Offiziell hieß der Ort 1965 nicht einmal mehr krimtatarisch Koktebel – »Blaues Siegel«, was an den alten Brauch der Viehhirten erinnerte, ihre Tiere mit einem blauen Siegel zu zeichnen –, sondern Planerskoje, nach dem Wort für Segelflugzeug, Vehikel einer jüngeren Passion, die der Gunst der Winde auf ihre Weise vertraute. Die Gegend gehörte zu einem Sperrgebiet, das ich als Ausländer an sich nicht betreten durfte. Meine Touristenkarte für die Krim von 1964, die Puschkin- und Tschechowgedenkstätten pries, verschwieg den angestammten Namen des Ortes und des Gründers des Hauses. Auf den Rußland-Baedeker von 1912 in meiner Tasche war freilich Verlaß. Da hieß es: »Von Ssudak nach Feodossija, zwei Straßen. a.Küstenstraße 52 Werst, Wagen 12–15, Mallepost l 1 / 2.Rubel. Die Straße führt über Taraktasch, Kosy, Otusy und Koktebel.« Für mich galt also a.
Auf das Woher? ließ sich leicht antworten. Morgens mit einem schnellen Tragflügelboot die 80 Kilometer an der Küste entlang von Jalta nach Ssudak. Von Ssudak zu sechst im offnen Jeep durch Täler und Steppe die 40 Kilometer hierher, umweht von den Düften von Salbei, Wermut und Thymian.
Schwerer zu bestimmen war schon, wer ich sei. Philologe? Übersetzer? Eher eigentlich Liebhaber russischer Poesie mit einer Vorliebe für die geistigen Pflanzstätten in »Dichters Lande«. Ich ahnte nicht, daß ich mich in Koktebel in der mit Petersburg bedeutendsten befand.
Am schwersten fiel mir der Bescheid, woher ich denn von »Max«, wie Maria Stepanowna vertraulich sagte, überhaupt wisse. Als ich Ehrenburg nannte, der in der Pariser Zeit mit Max befreundet gewesen war, hieß es brüsk: »Von diesem Klatschmaul?!« Ehrenburg war in Koktebel verschrieen, weil er sich angeblich zu sehr mit den Geschichten von der Verspieltheit des Dichters befaßt und seine mystifikatorischen Leidenschaften hervorgehoben habe. Und auch Ehrenburgs launige Anrede Maxens als »Großer Pan« und »Papa Silen« paßte nicht ins Dichterbild von Koktebel, wo Woloschin als der Weise der russischen Moderne galt, doch nicht für trunken vom Wein, für lüstern.
Ganz unvorbereitet war ich nicht. Zwar gab es damals keine Ausgaben von Woloschin, und die sowjetische Literaturgeschichte kannte ihn höchstens am Rande. In den zwanziger Jahren hatte ihn die proletarische Literaturkritik einen Konterrevolutionär, einen »lebenden Leichnam« genannt, und in den dreißiger Jahren konnten Lektüre und Besitz seiner Gedichte Grund für die Todesstrafe sein. Erst 1962 hatte Andrej Sinjawski ein kleines Porträt über ihn für die neue Literaturenzyklopädie geschrieben.
Durch Zufall war ich kurz vor meiner Reise auf die Berliner russische Ausgabe von Woloschins Gedichtsammlung »Taubstumme Dämonen« von 1923 gestoßen. Weil sich niemand sonst dafür interessierte, hatte ich sie in der Bibliothek des »Hauses der Kultur der UdSSR« als Dauerleihgabe erhalten. Sicher war das Büchlein aus der Hinterlassenschaft des »Russischen Berlin« der zwanziger Jahre dorthin gelangt: Gedichte aus den russischen Revolutionen von 1905 und 1917/1918, Gedichte über den Terror der französischen Revolution und eine Dichtung über den Protopopen Awwakum, den geistigen Führer der russischen Altgläubigen im 17. Jahrhundert, der mehrfach verbannt und 1682 auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden war.
Den russischen Aufruhr zu fassen nimmt das Titelgedicht des Bändchens Worte aus Jesaja 42,16 und 19 auf: »Aber die Blinden will ich auf dem Wege leiten, den sie nicht wissen … Wer ist so blind, als mein Knecht? Und wer ist so taub, wie mein Bote, den ich sende? Wer ist so blind, als der Vollkommene? Und so blind, als der Knecht des Herrn?«
Die »Taubstummen Dämonen« zeichneten ein Rußland- und Revolutionsbild, das dem herrschenden in keiner Hinsicht entsprach: Im Kapitel »Rußlands Weg« die Verse »Heiliges Rußland« vom 19.November 1917 in Johannes von Guenthers Übertragung:
Du doch liebtest seit der Kindheit Zeiten
Zellen rauh in Urwaldeinsamkeiten,
Weglos über Steppen Wanderschaft,
Büßerketten, freier Weiten Atem,
Prätendenten, Diebe, Apostaten,
Nachtigallenschlag und Kerkerhaft.
Zarin sein, das war nicht dein Verlangen –
Welch ein tolles Ding war angegangen.
Raunt der Böse doch: Gib alles weg,
Gib dein Gold den Reichen und den Prachern,
Macht den Sklaven, Kraft den Widersachern,
Deine Schlüssel den Verrätern keck.
Untergabst dich Worten dreist und Trieben,
Branntest Korn und Siedelungen hin,
Hingst Verderben an die alten Zinnen,
Gingst geschmäht und bettelhaft von hinnen,
Als des letzten Sklaven Dienerin.
Ists an mir, den Stein auf dich zu werfen?
Glut aus Leidenswegen zu verwerfen?
Tief gebeugt vor dir in Schmutz und Sand,
Preis ich bloßen Fußes Spur betroffen,
Heimatloses du, verbummelt und versoffen,
Du in Christo närrisches Russenland.
Wenige Tage später, am 23.November 1917 im Kapitel »Racheengel« die Bitte für Rußland um den Frieden der Demut: »Wir haben es gelästert, zerquatscht, verhöhnt, entblößt, versoffen, ausgespuckt … feilgeboten auf der Straße: Braucht keiner Land, Republik, Freiheit und Menschenrechte? O Herr … schick Feuer, Seuche, geißle uns. Deutsche von Westen, Mongolen von Osten – schick Sklaverei von neuem und für immer, in Demut die Judas-Sünde zu büßen bis zum jüngsten Gericht.«
Den Ernst meines Interesses zu beglaubigen konnte ich noch vorbringen, daß ich die Erinnerungen der Malerin Margarita Sabaschnikowa kannte, der ersten Frau des Dichters, die Rudolf Steiners Anthroposophie gefolgt war. Ihr Buch »Die grüne Schlange« war 1954 in Stuttgart erschienen. Max, wie er auch hier heißt, beschrieb die Malerin als ein naives Gemüt von kindlicher Weichheit, das seine frühe Körperfülle leicht zu tragen wußte und mit Paris spielend zurechtkam: »Max fühlte sich überall in der Welt wie der Fisch im Wasser, wenn er nur einige paradoxe Aussprüche daraus machen konnte. Sein Gleichmut und seine Heiterkeit wirkten auf mich in all diesem Chaos beruhigend. Ich bewunderte seine Toleranz und sah in ihm eine große Reife. Wenn er eine originelle Idee gefunden oder etwas Interessantes zu berichten hatte, glich er in seiner graziösen Tapsigkeit einem jungen Bernhardiner, der mit einem Lumpen zwischen den Zähnen spielt.«
Ob ich das Buch wohl für Koktebel besorgen könnte – so die abschließende Frage. Das Examen war offenbar bestanden. Maria Stepanowna stellte mir nun die Männer zu ihrer Rechten und Linken vor. Rechts Viktor Manujlow, Philologe aus Leningrad, links ein Redakteur der russischen Zeitschrift »Prostor« aus Alma-Ata. Manujlow nehme den dichterischen Nachlaß für eine geplante Ausgabe auf, der Journalist erwäge die baldige Veröffentlichung mehrerer Gedichte Woloschins. Beiden glückte das damals nicht. Erst 1977 erschien wieder eine kleine Ausgabe in der Leningrader »Bibliothek des Dichters«. Manujlow werde mich jetzt durch das Haus führen – Maxens Arche, sein Schiff mit den vielen Kojen. Zum Abschied sei ins »Unterdeck« auf einen Tee geladen. […]
SINN UND FORM 5/2009, S. 603-608