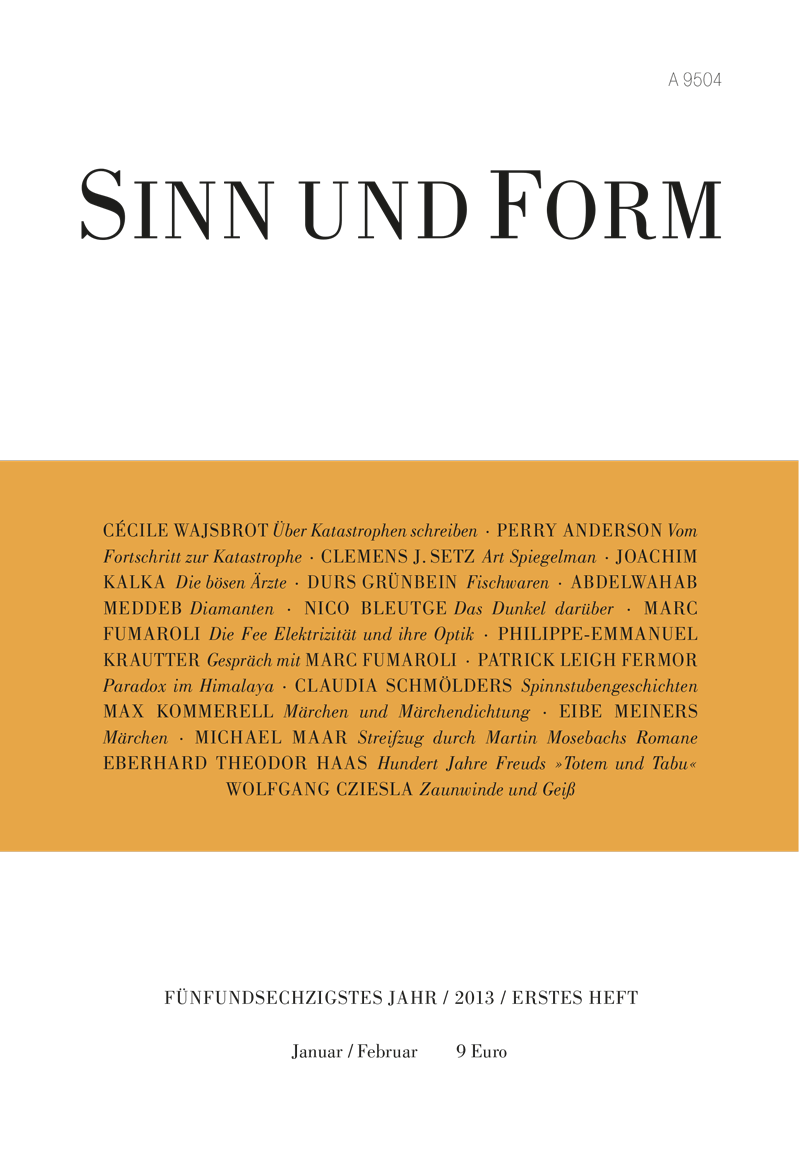Leseprobe aus Heft 1/2013
Maar, Michael
LIEBLINGSSTELLEN
Streifzug durch Martin Mosebachs Romane
Es ist Nicholson Baker, den ich mir bei meinem Streifzug als Cicerone denke. MeinLieblingsbuch von ihm trägt den wortspielerischen Titel »U and I«. Das »U« steht für John Updike, dem Baker in diesem Roman-Essay eine sehr persönliche Hommage macht, eine Hommage mit dem Blick des Anfängers – er hatte gerade seine ersten beiden Bücher veröffentlicht – auf den bewunderten und ein wenig beneideten Altmeister. Bakers Prinzip ist es, daß er sich nicht nur verbietet, Stellen in Updikes Werk nachzuschlagen, sondern sich auch vornimmt, nur auf seine Erinnerung zu hören. Das Prinzip hat etwas für sich. Literatur lebt ja fast ausschließlich von dem, was der Leser, wenn er das Buch zugeschlagen hat, davon in Erinnerung behält. Je stärker der Eindruck ist, den es gemacht hat, desto länger bleibt es in Erinnerung. Die Fähigkeit eines Buches, sich tintenfischgleich mit Tentakeln und Saugnäpfen im Gedächtnis des Lesers festzusetzen, ist noch kein hinreichender Beweis für literarische Qualität – man kann sich auch lebhaft an besonders grauenhafte Stellen in besonders miserablen Büchern erinnern; aber es ist eine notwendige Bedingung dafür. Was keinesfalls heißt, daß man sich wörtlich an Textstellen erinnern muß, ganz im Gegenteil. Es genügt auch die Erinnerung an eine bestimmte Atmosphäre oder an eine Plot-Pointe oder an einen Gefühlsmoment oder an einen bestimmten Geruch …
Wie etwa an den strengen Geruch von Fledermauskot in dem kleinen indischen Kabinett, in dem der Protagonist von Martin Mosebachs Roman »Das Beben« ein kurzes und heftiges Renkontre mit einer Restauratorin hat. Oder an den Geruch von abgestandenem Blumenwasser – oder eigentlich wohl des Katzenklos – in der leeren Wohnung, in der derselbe Held eine Nacht lang auf seine flatterhafte Geliebte Manon wartet. Die Atmosphäre dieser Szene hat sich bei mir besonders festgesaugt. Was passiert in ihr? Schlechterdings nichts. Die Geliebte kommt und kommt nicht, und die Zeit wird dem Helden lang. (Ich verwende das Wort Held im saloppen, nicht im strengen Lewitscharoffschen Sinn.) Er wartet, und es geschieht nichts, außer daß es allmählich dunkel wird und die Straßenlaternen ihr weißes Licht durch die Schlitze der Jalousie werfen und eine Katze aufs Fensterbrett springt. Einmal hat der Held das Gefühl, Manon sei doch schon in der Wohnung und erwarte ihn im Schlafzimmer. Liegt sie nicht unter der Daunendecke im Bett? Ihr Körper scheint sich unter dem Plumeau abzuzeichnen, doch als er ihre Füße berühren will, hat sie sich in Luft aufgelöst.
Eine ganze Nacht verbringt der Held auf dem Sofa in der heißen Wohnung, erst die Morgenstunden verschaffen ihm etwas Kühlung. Was die Geliebte später als Entschuldigung für ihr Ausbleiben vorbringt, daran kann er sich kaum noch erinnern: entweder eine sterbende Tante, die besucht werden mußte, oder der Verlust ihrer Handtasche samt Telefon. Es ist ihm auch nicht wichtig, denn im Grunde hat er die unbequeme Nacht auf dem Sofa in vollen Zügen genossen.
Und der Leser tut es ihm darin gleich. Das Hypnotische dieser Szene liegt darin, daß der Autor die Zeit verrinnen läßt, die reine Zeit, die ebenso wie die Geliebte nicht faßbar ist und dennoch rätselhaft präsent. Man sieht gewissermaßen die Sandkörnchen, wie sie durchs Stundenglas rieseln.
Was wären andere Lieblingsstellen, die man nicht nachschlagen muß, weil sie sich fest im Gedächtnis angedockt haben? Sie sehen, ich bin hier in etwas gerutscht, das man in Anlehnung an Baker »M&M« nennen könnte. »M&M« auch insofern, als ich wie in »U and I« mit dem Blick des blutigen Debütanten, der gerade seinen ersten Roman veröffentlicht hat, das Werk des bewunderten Meisters vor allem technischhandwerklich betrachten möchte, immer mit der Frage im Hinterkopf: Wie schafft der Hund das nur? Wie schafft er es zum Beispiel, in der Warte-Szene dieses Gefühl der langsam verrinnenden Zeit zu erzeugen? Um das in seiner Filigran-Technik zu zeigen, müßte man die Passage nun doch genau auseinandernehmen. Ich möchte hier aber weiter dem Ruf meiner Lieblingsstellen folgen – und dabei wie Baker der Versuchung widerstehen, sie nachzuschlagen.
Meine frühesten Erinnerungen gehen auf das FAZ-Magazin zurück. Dort schrieb der mir unbekannte Martin Mosebach Kolumnen oder kurze Pastiches über italienische Redensarten, illustriert mit jeweils einer Anekdote, über die ich fast Tränen lachen mußte. In einer kam ein Elektriker vor, der irgend etwas auf einem Dach zu reparieren hatte, eine Antenne vermutlich; es war ungeheuer komisch, auch wenn ich sonst nichts mehr davon weiß. Wer war dieser Autor? Das nächste, was ich von ihm las, war die voluptuöse Beschreibung eines großen Feinschmecker-Gelages, aus der ich erfuhr, daß die Franzosen den Bordeaux nur für die Engländer produzierten und für sich selbst den Burgunder behielten. Der letzte, mich damals etwas frivol anmutende Satz – man las damals noch viel von der Sahel-Zone – lautete: »Manche freuen sich schon auf den Whiskey«.
Voluptuöse Beschreibungen sind bei Mosebach fast ein Erkennungszeichen. Mitunter gibt es, wenn es etwa verfallene indische Paläste betrifft, geradezu Orgien der Beschreibungskunst, einer Kunst, die sich durch das Aufgebot aller möglichen Akribie eben jenem Verfall entgegenzustemmen scheint. Was schon im Verschwinden begriffen ist, soll wenigstens noch einmal in der Schrift fixiert werden. In der Erinnerung bleibt von diesen Orgien nur, daß es welche waren, die Details verlieren sich. Was damit zu tun zu haben könnte, daß sie dem Unbelebten gelten, dem wir nicht die gleiche Aufmerksamkeit schenken mögen wie dem Lebendigen. Jedenfalls spricht die Erinnerung deutlicher, wenn es nicht um Stein, sondern um Fleisch und Blut geht.
Es müssen dabei gar nicht Menschen sein. Niemand, der Mosebachs letzten Roman »Was davor geschah« gelesen hat, wird die musikalische Introduktion vergessen, die uns, eigentlich zum ersten Mal richtig und umfassend, den Gesang einer Nachtigall beschreibt. Es ist ein kleines poème en prose, das er dieser Nachtigall und ihrer sich zu unerhörten Höhen steigernden Arie abgewinnt; eine Beschreibung, die zu dem Schluß gelangt: wer einmal eine solche Nachtigall gehört hat, der kann nur davon abraten, dieses Wort leichtfertig in ein Gedicht aufzunehmen, denn es brächte den schwankenden lyrischen Kahn zum Kentern. Das Pendant zu dieser Nachtigall ist der Kakadu, dem eine ebenso eindringliche Beschreibung gilt, wie er sich in seinem Putzritual aufplustert und dann wieder in Starre verfällt; auch das eine große Miniatur, die kein Leser des Buches vergessen wird.
Mosebachs Kunst der Beschreibung widmet sich auffällig oft der Tierwelt, das ist sein Tribut ans Lebendige, an die Schöpfung, wenn man so will, in der das Einzelwesen nicht weniger wichtig oder wertvoll ist, nur weil es zufällig nicht sprechen kann. Außer der Nachtigall und dem Kakadu, der übrigens der einzige in dem Buch ist, der den kompletten Überblick über das Geschehen bewahrt, gibt es in »Was davor geschah« auch noch eine Katze, die aus der Wohnung flieht und in der Stadt herumstreunt. Der Erzähler versetzt sich in diese freiheitsliebende Katze so sehr hinein, als wäre er in einem früheren Leben selbst eine gewesen; wie auch der Held des Romans »Das Beben « Macht über eine Katze hat und sie mit seinen Blicken hypnotisieren kann. Die verwilderte Katze in »Was davor geschah« wird am Ende halb-symbolisch von einem Auto überfahren; in ihrer letzten Minute bewegt sie noch langsam ihre Pfoten in der Luft, als übe sie eine neue Art der Fortbewegung im Körperlosen … auch das eine der Miniaturszenen, die dem Tier eine metaphysische Würde verleihen. In seinem neuen, noch im Entstehen begriffenen Roman wird der Erzähler in China in einem Restaurant genötigt, eine frisch gefangene Schildkröte, die man ihm zuvor noch unter die Augen hält, zu verzehren. Es ist eine Sünde, die er sich nicht verzeihen kann und die ihn bei einem späteren Besuch auf dem Balkan dazu animiert, eine Schildkröte, die er zufällig in einem Teppichladen entdeckt, freizukaufen und in die Natur zu entlassen.
Es ist nun nicht so, um noch eine Sekunde bei den Tieren zu bleiben, daß alle Mosebachschen Figuren gefühlsduselig wären. Der ziemlich unsympathische und um so interessantere Hans-Jörg in »Was davor geschah «, der ständig zurückgesetzte Sohn eines Weizsäckerhaften Übervaters, genießt es in dessen italienischem Feriendomizil sehr, daß er vom Bett aus das Massaker betrachten kann, das eine Honiggirlande unter den Fliegen anrichtet. Ja, denn auch Insekten haben es verdient, daß man sich erzählerisch um sie bemüht. Eine der eindringlichsten Passagen des Romans »Eine lange Nacht« schildert uns auf zwei oder drei Seiten, wie eine Ameisenkönigin in einem offenen Kamin versucht, ihr Volk vor den hochzüngelnden Flämmchen zu retten und wie sie am Ende, als die Glut sich in den Holzscheiten immer weiterfrißt, einen heroischen Selbstmord begeht, indem sie sich in das Feuer stürzt. Wer unbedingt will, kann all das auch symbolisch lesen, aber ich finde, das ist gar nicht nötig; die Ameise hat genausoviel poetisches Eigengewicht wie etwa die berühmte Kuh aus dem »Beben«, die im Flughafen einen Pappkarton zermahlt – meiner Ansicht nach enthielt er Druckerpapier. Dieser Kuh allerdings gibt Mosebach tatsächlich ein symbolisches Doppelleben, indem er sich vorstellt, wie sie durch nichts als ihre kauende Real-Präsenz jede deutsche Talkshow sprengen würde; eine Passage, die dem Publikum immer besonders gefiel, der ich aber die Kaminszene vorziehe.
Was uns all diese Miniaturen zeigen, kleine hängende Gärten über dem epischen Strom der Erzählung, ist eine der bemerkenswertesten Fähigkeiten dieses Autors. Mosebach macht aus Kleinem etwas Großes. Jeder hat schon Ameisen, Katzen, Schildkröten oder sogar Kakadus betrachtet oder beobachtet, aber eben nicht mit dieser Versenkung, Hingabe, Konzentration und Geduld. Mosebachs Qualität ist diese erzählerische Geduld. Natürlich muß er das, was er so genau beobachtet, dann noch in die, wie es bei Proust heißt, Ringe eines schönen Stils einschließen; denn ohne sprachlichen Reiz hilft alles Beobachtete nicht und wird die Genauigkeit zur Pedanterie. Das ist Mosebachs geringstes Problem; seine Sprache ist ein farbiges Fest, in dem man sich keine Minute langweilt, perfekt rhythmisiert und entgegen allen Vorurteilen so uneitel und ungespreizt wie nur möglich, ganz nah beim Gesprochenen, hochmusikalisch, bilderreich und die Funken des Komischen noch aus dem unscheinbarsten Kiesel schlagend.
[...]
SINN UND FORM 1/2013, S. 127-134