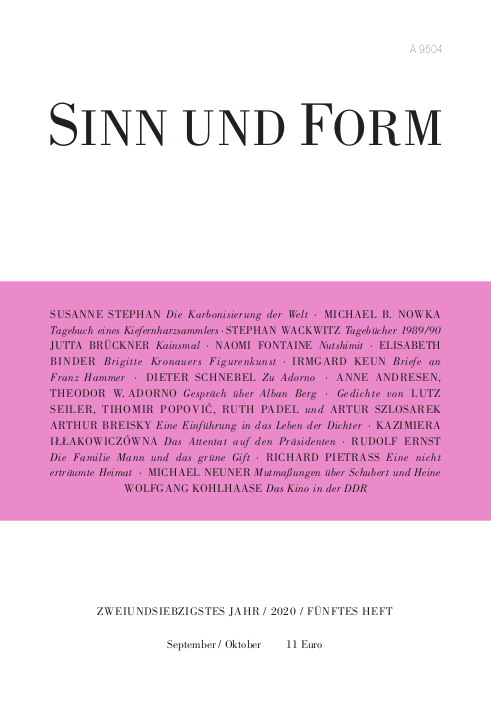
[€ 11.00] ISBN 978-3-943297-55-3
Printausgabe bestellen[€ 8,00]
PDF-Ausgabe kaufenPDF-Download für Abonnenten Sie haben noch kein digitales Abo abgeschlossen?
Mit einem digitalen Abo erhalten Sie Zugriff auf das PDF-Download-Archiv aller Ausgaben von 2019 bis heute.
Digital-Abo • 45 €/Jahr
Mit einem gültigen Print-Abo:
Digital-Zusatzabo • 10 €/Jahr
Leseprobe aus Heft 5/2020
Fontaine, Naomi
Nutshimit
Nutshimit ist das Landesinnere, das Land meiner Vorfahren. Jede Familie kennt ihr Waldstück. Die Seen sind Straßen. Die Flüsse zeigen den Norden an. Wer unvorsichtig ist und zu tief in den Wald eindringt, kann sich an den Zugschienen orientieren.
Nutshimit, ein Ritual für Karibu-Jäger. Klare Luft, für die Alten unverzichtbar. Seit ihre Beine an Kraft verloren haben, zieht es sie nur noch zum Atmen in die Wildnis.
Nutshimit, ein unbekanntes, aber nicht feindseliges Territorium für jemanden, der seinen Geist zur Ruhe kommen lassen will. Früher waren diese Wälder von Männern und Frauen bewohnt, die mit den Händen nahmen, was die Erde ihnen schenkte. Sie leben nicht mehr, aber sie haben auf Felsen, Wasserfällen und grünen Fichten ihren Abdruck hinterlassen, ihren Blick.
Nutshimit bringt dem Verwirrten Frieden. Inneren Frieden, nach dem er sich verzweifelt sehnt. Stille, nachdem er nächtelang seine Angst herausgeschrien hat, ohne von irgendwem gehört zu werden. Die Stille des Windes, der durch Tannennadeln streicht. Die Stille eines Rebhuhns, das neben Artgenossen durch den Wald stakt. Die Stille eines Bachs, der unter meterhohem Schnee seinen Weg fortsetzt.
Der junge Mann möchte hören, was das Land seiner Vorfahren ihm zu sagen hat. An diesem Morgen besteigt er den Zug.
*
Sie sagen: Wir nehmen zum Zug. Sie würden nie sagen: Wir gehen zum Bahnhof, zu den Gleisen. Den Zug nehmen bedeutet, weit wegzufahren. Sich die lange Reise durch Nutshimit anzueignen. Man nimmt den Zug, weil er ein vertrautes Transportmittel ist. Das einzige, das einen durchs Landesinnere nach Norden bringt. Unterwegs macht er mehrmals halt, um Leute auf freier Strecke ein- oder aussteigen zu lassen. Der Zug endet in Matimekush-Lac John, der Stadt des Eisenerzes.
Das kleine Gebäude, das als Bahnhof dient, ist alt und mit einem grauen Blechdach gedeckt. Die Wände sind beige. Drinnen ist es im Winter sehr kalt, weil die Leute die Tür offenlassen. Ein paar verlorene orange Plastikstühle, um auf den Zug zu warten, der zweimal pro Woche frühmorgens ankommt. Die Fahrgäste warten draußen, rauchen eine Zigarette, trinken einen Kaffee mit viel Zucker. Niemand ist ungeduldig. Alle wissen, daß die Reise bald losgeht, entweder zu einer der Jagdhütten, die unweit der Eisenbahnstrecke im Wald verstreut sind, oder nach Matimekush. Familien mit Kindern und alte Leute reisen am liebsten in der kalten Jahreszeit mit dem Zug. Sie haben ihre dickste Winterjacke dabei, mehrere Schachteln Zigaretten und Kartons voller Lebensmittel, genug für eine Woche. Die Männer richten sich nach der Jagd, sie nehmen den Zug, wenn sie das Bedürfnis nach Abgeschiedenheit haben. Sie haben weniger Gepäck, außer Gewehren, Schneemobilen, warmer Kleidung und Benzinkanistern nehmen sie nichts mit. Kein Fleisch, sie vertrauen auf ihr Jagdglück, eine Frage der Ehre. Keinen Alkohol, aus Respekt vor der Erde. Zum Abschied Umarmungen, die Babys und Kleinkinder auf dem Arm, man sagt bis bald, man weint nicht, denn man weiß, daß Männer, die in den Wald ziehen, dort Ruhe finden. Man bedauert sie nicht, man beneidet sie. Sie heben grinsend die Hand, das Mittagessen in einer Dose. Es ist acht Uhr. Der Beginn einer langen Reise, die ein paar Stunden, den ganzen Tag oder bis spät in die Nacht dauert, je nachdem, wo sie hinfahren. Der Zug setzt sich langsam in Bewegung, beinahe lautlos, wie um uns seine Bedeutung spüren zu lassen.
Auf dem Rückweg kommt er immer im Dunkeln an. Eine Menschenmenge erwartet ihn, als wären die Jäger monatelang fortgewesen. Die meisten haben nur eine Woche in der Wildnis verbracht. Einige auch länger, sie werden am Abend später zu Bett gehen. Jeder wird abgeholt. Viele Hände tragen das Gepäck. Umarmungen, glückliche Gesichter. Die wichtigsten Fragen werden gestellt: Und, wie viele Rebhühner, Hasen, Karibus hast du erlegt? Eines nach dem anderen fahren die Autos ab, vollbesetzt, voller Leben.
*
Der Sommer kehrt wieder, der Sohn kommt nach Hause. Er hat sich verändert. Er ist älter geworden. Die Mutter schließt den jungen Mann in die Arme. Sie weint, weil sie seine Stimme, seine Art nicht wiedererkennt. Das ist der Wechsel der Jahreszeiten. Sie hofft, daß es lange Sommer bleibt.
*
Der Mann steht kerzengerade da, in schwarzem Anzug und Krawatte, mit einem ehrgeizigen Lächeln. Er steht kerzengerade da, und er ist groß. Einen Arm hat er um die Frau neben sich gelegt, drückt sie an sich, eine kleine Frau mit dunkler Haut und dunklem Haar, im weißen Kleid, die mit geschlossenen Lippen lächelt. Hinter ihnen ist es Herbst …
*
Ein toter grauer Pelz vor blutrotem Schnee. Geschossen mit dem Gewehr, das der Innu über der Schulter trägt, seine schmalen Augen schimmern, es ist der Stolz des Mannes auf seine Beute, wie ein kleiner Junge, die Lippen zusammengekniffen, eine Hand um den Hals des Tieres. Ein Knie am Boden, bereit loszulaufen. Ein Krieger, immer auf der Hut …
*
Im Kopf Gelächter. Im Kopf Gespräche über die Wahl des Reservatschefs, über Bücher, über die neuen Schülerinnen und Schüler, über Kinder, die groß werden, alles durcheinander. Die Verdoppelung könnte ein Hinweis sein, rote Schlucke, weiße Schlucke. Längst ohne jeden Geschmack. Ohne jeden Geruch. Ungenaue, dabei doch so wichtige Worte kamen über die Lippen und landeten vor der Haustür des Nachbarn. Filmriß.
*
Die Aufsässigen leisten Widerstand, wehren sich, ihr Kampf: das eigene Fleisch und Blut großziehen. Damit sie zu Männern und Frauen werden, zu einer Nation, die ihnen ähnelt, die niemanden unterdrückt, die fortbesteht, die lebt.
Der alte Mann mit der weißen Haut hat seinen Federschmuck aufgesetzt und seine bunten Kleider angezogen. Er ist in die Mokassins geschlüpft, die ihn zu einem Indianer machen. Die traditionelle Pfeife in der Hand, begibt er sich zu Verhandlungen mit dem Staatschef.
*
Mit vierzig entdeckte sie ihre wahre Natur. Mutter, mehrfache Großmutter. Eine Frau mit Erfahrung, mit vielen Berufen, aber keine Karrierefrau. Ehemaliges Mitglied des Reservatsrats. Ehemalige Kandidatin für das Amt des Reservatschefs, unterlegen, nicht aber besiegt. Freundlicher Blick, vertrautes Lächeln. Mit vierzig glaubte sie, sich selbst zu kennen, und brach mit einer kleinen Gruppe auf, um dem Weg ihrer Vorfahren zu folgen.
Im Frühjahr kehrten die Nomaden in ihr Dorf zurück, der Fluß war ihr vorgezeichneter Weg. Sie überwanden Berge und Täler, ruderten, wanderten, trugen an Stromschnellen oder zwischen zwei Seen das Kanu umgedreht auf den Köpfen. Sie waren es nicht anders gewohnt, sie mußten eins werden mit der Natur, um zu überleben. An ihre Stelle treten, um zu existieren.
Sie war nicht bereit für das, was sie erwartete. Wer wäre das schon? Der Zug hatte sie am Meilenstein 150 abgesetzt. Sie hatten in einer Jagdhütte zu Abend gegessen. Das Feuer knisterte im Ofen, es war angenehm warm. Der Schornstein rauchte um die Wette mit den vier Frauen und dem jungen Mann, die sich fröhlich unterhielten. Alle gingen früh schlafen. Im Morgengrauen würden sie ihre Sachen packen und aufbrechen.
Es war der Anfang und das Ende von etwas. Wandern. Erst einmal galt es, einen Fuß vor den anderen zu setzen, den Rucksack geschultert, und sich Zuversicht auf die Lippen zu heften. Zum Fluß wandern. Paddeln. In einem Kanu kniend, das diese Strecke schon tausendmal zurückgelegt hatte. Dem Fluß folgen, in seinem Lauf den Weg erkennen, den Weg der Ahnen, ihren eigenen Weg.
Ein paar Tage später wollte sie zurück, in ihr Haus, in ihr Bett, zu ihrem Liebsten, in die Wärme, wollte sich sauber und frisch fühlen und morgens einen Kaffee mit Milch und Zucker trinken. Alles in ihr sträubte sich dagegen, wie eine Nomadin zu leben und auch nur einen Moment länger das Lebensnotwendige auf dem Rücken zu tragen. Sie war nicht wie die Frauen früher, für die kein Tag zu lang, keine Anstrengung zu groß war. Die jeden Berg bestiegen, als wäre es der erste. Wie gegen die Natur ankommen, die eigene Natur?
Dann dämmerte der Morgen, genauso trocken wie die Nacht. Zum ersten Mal seit ihrem Aufbruch holte sie den kleinen Taschenspiegel hervor, den sie aus Eitelkeit oder Wehmut angesichts dessen, was sie zurückließ, mitgenommen hatte. Sie sah, daß ihre Haut von der Sonne gebräunt war, das Haar fettig, die Augenbrauen ungezupft, und daß sie müde war. Sie ärgerte sich über ihr Spiegelbild, und ihr Gesicht veränderte sich. Ein paar Sekunden lang glaubte sie einen vertrauten Willen aufblitzen zu sehen, den wohlbekannten Blick der Frau, die sie zur Welt gebracht hatte. Die Augen ihrer Mutter in ihrem eigenen Gesicht. Herausforderung, Kampf, Suche, aber keine Niederlage, nie mehr. Mit dem nächsten Atemzug nahm sie zum ersten Mal ein Stück Vergangenheit in sich auf, und es gesellte sich zu dem Frieden des neuen Tages.
Paddeln, wandern, das Kanu umtragen, das Zelt aufschlagen, essen, schlafen, packen, paddeln. Das war jetzt ihr Leben. Zumindest für eine Weile. Eine Leihgabe ihrer Vorfahren. Ein freiwillig angenommenes Erbe. Der Weg war vorgezeichnet, tausend andere hatten ihn vor ihr mit dem Kanu zurückgelegt. Sie mußte sich nur von ihnen führen lassen. An die Verheißung eines milderen Morgens glauben. Mit eigenen Händen das kristallklare Wasser schöpfen. Frei sein, mit der einzigen Einschränkung, überleben zu müssen. Umgeben von hochgewachsenen Fichten und knorrigen Laubbäumen, sah sie die Spur des Hasen und stöberte das lautlose Rebhuhn auf. Sie dankte den vier anderen, daß sie durchgehalten hatten. Sie dankte dem Himmel für die lauen Maiennächte. Bis zum letzten Schritt dankte sie dem Schöpfer, daß er sie geführt hatte.
(…)
Aus dem Französischen von Sonja Finck
SINN UND FORM 5/2020, S. 636-646, hier S. 636-639
