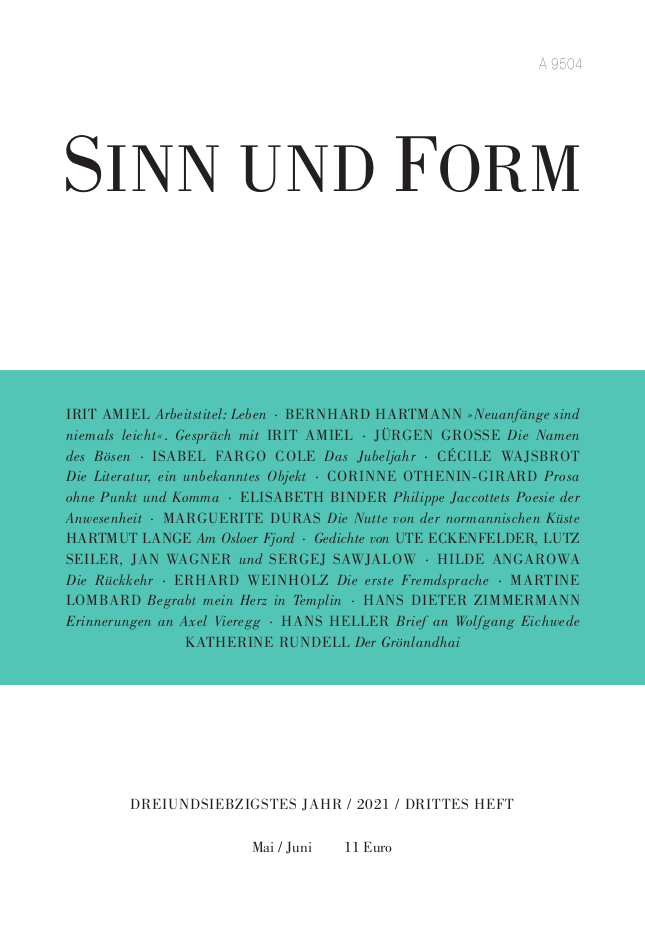
[€ 11.00] ISBN 978-3-943297-59-1
Printausgabe bestellen[€ 8,00]
PDF-Ausgabe kaufenPDF-Download für Abonnenten Sie haben noch kein digitales Abo abgeschlossen?
Mit einem digitalen Abo erhalten Sie Zugriff auf das PDF-Download-Archiv aller Ausgaben von 2019 bis heute.
Digital-Abo • 45 €/Jahr
Mit einem gültigen Print-Abo:
Digital-Zusatzabo • 10 €/Jahr
Leseprobe aus Heft 3/2021
Angarowa, Hilde
Die Rückkehr. Aus einem Reisetagebuch (1957)
Vorbemerkung
Annähernd dreißig Jahre war Hilde Angarowa, geborene Schießer, Deutschland ferngeblieben, bis sie sich im März 1957 das erste Mal wieder nach Berlin, Hauptstadt der DDR, wagte. »Germania begrüßt seine treulose Tochter«, so eröffnet sie ihr Reisetagebuch. Als junge Bildhauerin hatte sie 1929, frohgemut und frischvermählt mit einem rotblonden Sibirjaken, die Stadt gen Moskau verlassen; zurück kam sie als gestandene Übersetzerin russischer Literatur.
Ihre »Lehrjahre« für diesen Beruf erscheinen beispiellos dramatisch, hart an den Abgründen deutsch-russischer Geschichte im 20. Jahrhundert. Sie war schon da, als die Garde deutscher Kommunisten nach der Machtergreifung ins sowjetische Exil kam, war dabei, als die Sowjetunion in den Großen Terror driftete und ihre deutschen Kampfgenossen als Spione abservierte, wurde kalt erwischt vom Pakt zwischen Hitler und Stalin und davon, daß dieser Verbündete alsbald ihre neue Heimat überfiel.
An der Seite ihres Mannes, Alexej Angarow, der eine steile Parteikarriere machte, war sie bis 1933 im Marx-Engels-Institut Komsomolsekretärin gewesen und hatte dessen »Säuberung« miterlebt. Der Versuch, sich als Kulturarbeiterin »unter Tage«, beim U-Bahn-Bau, auf die eigenen Füße zu stellen, war beendet, als 1935 ihre Tuberkulose wieder ausbrach. Sie fand eine Anstellung als Redakteurin in der von der Komintern betriebenen Verlagsgenossenschaft für ausländische Arbeiter (Vegaar), wo sie schon bald ihr erstes Buch übersetzte, erlebte deren Schließung und die Ausmerzung des halben Personals. Auf die Scheidung von ihrem Mann, der später als »Volksfeind« erschossen wurde, folgte die Bezichtigung, Frau eines Volksfeinds gewesen zu sein, die sie zum Glück nur den Job kostete. Nachdem die Vegaar als sowjetischer Verlag für fremdsprachige Literatur wiederauferstanden war, erkämpfte die Angarowa ihre Wiederanstellung, begann zu übersetzen, hörte nie wieder damit auf.
Und hatte seit 1933 aus der Ferne mitansehen müssen, wie ihre gutbürgerliche jüdische Familie im brandenburgischen Cottbus, dem sie mit achtzehn den Rücken kehrte, ins Verderben gerissen wurde: Keine fünf Wochen nach der »Machtergreifung« der Nazis rotteten sich die ersten aufgeputschten Parteigänger vor dem Modekaufhaus des Vaters zusammen, wenig später war der Boykott jüdischer Geschäfte durchgesetzt, an den Schaufenstern klebten die gelben Plakate. Die Schießers wurden enteignet und ins »Judenhaus « umquartiert; langes Warten auf die Ausreise, während die ersten Transporte zur Deportation rollten; im letzten Moment gelang es dem vorausgeeilten Bruder, die Eltern nach Argentinien zu lotsen; nicht mehr zu helfen war der Schwester in Köln, die mit Mann und Kindern nach Litzmannstadt (Łódź) deportiert und in Kulmhof umgebracht wurde.
Eine Zeitenwende später ist Hilde zurück im geteilten Berlin, bei der Dachdeckerwitwe Liebig in der Taubenstraße, Nähe Gendarmenmarkt, in Pension. Vier Wochen auf Einladung der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft (DSF) – Parlamentärin gewissermaßen der Sieger und Befreier, die nunmehr als Großer Bruder der »guten Deutschen « anzusehen sind, in diese Rolle muß sie erst noch finden. Zusätzlich »geködert« mit einem Übersetzerpreis nebst 3500 Mark Prämie. Zwei ihrer in Moskau erschienen Übersetzungen gilt es für Neuausgaben in DDR-Verlagen zu redigieren, neue Aufträge zu akquirieren, die Stadt ihrer Jugend ans Herz zu drücken – und noch das:
»Hansel, ich will nach Cottbus, du bist zwar ein großer Mann, aber vielleicht kommst du mit. Er sagt, nein, warum denn? Ich sag, wie bei einer Operation: wenn einer die Hand hält, wird es leichter.« Wessen Beistand wird hier erbeten?
Hansel, das ist der Dichter Johannes R. Becher, seit drei Jahren Kulturminister der DDR. Hilde Angarowa zählte zu den vielen Frauen in Bechers Leben; eine der am wenigsten bekannten, wenngleich vielleicht die längste Beziehung von allen. Die beiden hatten sich Mitte der zwanziger Jahre kennengelernt, kaum daß sie in Berlin war, und im Sommer 1926 in Karl Raichles anarchistischer Künstlerkolonie im schwäbischen Urach, Bechers alljährlichem Sommerrefugium zu jener Zeit, zueinandergefunden.
Sieben zwischen 1928 und 1939 von ihm an Angarowa gesandte Briefe befinden sich im Becher-Archiv der Akademie der Künste, zwei davon gedruckt in Rolf Harders Briefausgabe von 1993. Die Angarowa hat sie nach seinem Tod an Lilly Becher übergeben, mit der sie befreundet war; eine bemerkenswerte Geste – Liebesbriefe immerhin, an eine Konkurrentin. Hildes Briefe hat der Dichter wohl nicht aufbewahrt; einige liegen als Entwurf in ihrem Nachlaß in Bremen, Forschungsstelle Osteuropa.
Als die beiden sich 1933 in Moskau wiedersahen, war Angarow schon wieder aus ihrem Leben verschwunden, sie allein mit Kind, krank und in existentieller Not. Die fragile, explosive Gemeinschaft der Politexilanten in einem Klima zunehmender politischer Repression, Intriganz und Verdächtigung ließ offenbar auch libidinöse Verwicklungen zu – schwer vorstellbar dennoch, welcher Raum ihrer Beziehung blieb, da Becher seit 1935 mit Lilly verheiratet war, außerdem bald schon liiert mit Josephine Boss, der Frau des Gynäkologen Dr. Adolf Boss, der in Workuta im Lager einsaß, während sie zu ihrer Sicherheit eine fiktive Ehe mit Bechers Mitarbeiter Franz Leschnitzer eingegangen war. »Bitte sei mir nicht bös, wenn ich unser nettes, aber belangloses erotisches Intermezzo beende«, beschied Angarowa Becher 1939 kühl, jedoch: »Ich möchte Dich als Freund nicht gern verlieren. Wir kennen uns aus Deutschland. Und alles was ich noch aus Deutschland hab, sei es ein Kochtopf, ein Hemd oder ein Mann, das halte ich hoch in Ehren.« Und später, aus der Lungenheilanstalt: »Ich verzichte auf das Vergnügen deiner intimeren Bekanntschaft, wenn die dich hindern sollte, mir praktisch ein Freund zu sein.« Sie verlange keine Protektion, keine Befürwortung von Unfähigkeit, nur eine unvoreingenommene Beurteilung ihrer Arbeit. Es ging ums Überleben, und die Exilzeitschrift »Internationale Literatur«, der Becher vorstand, hätte ein Rettungsanker sein können.
Mit Bechers unverzüglicher Rückkehr nach Deutschland 1945 waren sie einander aus den Augen geraten. Nun also ein spätes Wiedersehen in Berlin. »Goldene Hochzeit«, wie sie an einer Stelle ihres Tagebuchs frotzelt. Gleich am zweiten Tag bestellt er sie zu sich ins opulente Büro am Molkenmarkt. Im Nu ist die alte Vertraulichkeit wiederhergestellt. »Dünn ist er geworden und wieder anders.« Becher erholt sich von einer Krebsoperation, ist streng auf Diät.
Ein Jahr ist vergangen seit der Geheimrede Chruschtschows, ein halbes seit den Ereignissen in Budapest. Der Harich-Prozeß ist gerade eine Woche her. Während Hilde in Berlin weilt, findet das ZK-Plenum statt, auf dem Mielke die Attacke gegen Janka fährt. Der Kampf um Lukács, Bechers letzte Schlacht, läuft noch, er wird sie verlieren, sich im September von ihm lossagen; nur nützen wird es nichts mehr. Er wird abdanken.
Im März ist Becher faktisch bereits entmachtet. Er hat jetzt anscheinend Zeit für die Angarowa, sie kommt ihm gerade recht. Der Minister setzt sich ans Steuer seines gletscherblauen EMW 327 und fährt mit Hilde an den Ort ihrer Kindheit.
Zuvor lädt er sie zu sich nach Bad Saarow, ins »Traumgehäuse«. »Hinterm See klang eine Glocke, lange und fern. ›Du, das ist Vineta!‹, sagte Hans. Und dann im Bungalow, wir zwei allein: ›Mach das Huhn warm, deck den Tisch, nimm dir eine Spargelkonserve.‹ – Den ganzen Abend nur ernste Gespräche.«
Wozu der Dichter sich zum Minister machen ließ, will sie wissen. Ob er sein Volk umformen wolle? »I wo! Macht, Stellung, Ansehen, solch ein Leben.« Und er tischt ihr die Geschichte vom Vater auf, dem königlich-bayrischen Oberstaatsanwalt, dem er es nachträglich habe beweisen wollen. Sie ist sich nicht sicher, wie ernst er es meint. »Wenn ich je gekämpft hab – und ich hab nicht gekämpft, ich hab geschrieben«, erläutert er, »so war das Ziel, ein Häuschen im Grünen zu haben wie dieses, ein Motorboot, ein Segelboot, ein Auto. Aber das wollte ich nicht für mich allein, sondern für alle, darauf kommt es an, und daraus ergibt sich das andere.« Spontan entwirft sie ihr Gegenbild: »Ich hab mir das nie so überlegt, aber wenn ich es jetzt formuliere, wirds ungefähr so: Ich möchte, daß keiner mehr erniedrigt wird, daß jeder das Beste aus sich macht, das in ihn hineingelegt ist, daß sich jeder freuen kann, wenn Sonne auf Bäume scheint und Musik spielt. Das Häuschen kommt nachher … Ich komme dir wohl sehr komisch vor?« Etwas verstiegen, befindet er und bringt die Rede auf Brecht, Thomas Mann und andere, über die er in ähnlicher Weise, im Zusammenhang mit Bankkonten, spricht. »Versuch mal, von der Seghers zwanzig Mark zu borgen!« Wenn jemand mit ihm über seine Gedichte reden wolle, laufe er weg oder schmeiße ihn raus.
Viel sprechen sie in diesen Tagen über Politik, wohl mehr als ihm lieb ist; die Angarowa ist begierig auf Informationen aus erster Hand. Klartext schon bei der ersten Begegnung im Büro: »Er sagt: Du denkst wie Lilly, ich denk anders. Bei ihm war Ordnung, jetzt geht’s hin und her.« Bei ihm, das meint: unter Stalin.
Dem hohen Amt zollt die Freundin Respekt: »Kulturminister in diesem verworrenen zwiegespaltenen Land, wo sich so vieles vielleicht für die Welt entscheidet, dazu kann man kein Michailow sein.« Sein sowjetischer Amtskollege, ein blasser Funktionär. »Bei uns sind die Reserven enorm, da buttert man lustig hinein, ab mit Schaden, Deutschland muß auf kulturellem Gebiet die Pfennige zählen.« Dazu die massive Abwanderung der Leute in den Westen. Die Leute gehen, weil sie nicht wollen, daß ihnen jemand in ihr Leben hineinredet, so einfach erklärt Becher es ihr.
Dennoch, und wohl nicht zufällig nach einer Vorstellung von Brechts »Galilei«, regt sich Zweifel: »Ob mein guter Freund, der Geist über den Wassern, mit seinem Augenzumachen und ›wir waren anders informiert‹, Stalinallee und ›Dank euch, ihr Befreier‹, immer eine sehr eindeutige und mutige Rolle spielt?«
Wieviel weiß Angarowa über die Vorgänge, die Becher zusetzen, wieviel läßt er sie wissen? Während der Prozeß gegen Aufbau-Chef Janka vorbereitet wird, arbeitet sie mit der Lektorin Karin Berndt in den Räumen des Verlags an der Redaktion ihrer FedinÜbersetzung. Die Schockstarre der Belegschaft nach der Verhaftung ihres Chefs kann ihr nicht verborgen bleiben. Davon steht nichts im Tagebuch. »Ich hatte eine Stunde bis zum ›Diner‹ mit Gysi und las inzwischen das Material über die Harich-Affäre.« Welches Material? Ein Verhandlungsprotokoll, das Stenogramm der ZK-Tagung aus Bechers Hand – oder doch nur das, was das Neue Deutschland darüber schrieb?
Ein paarmal nimmt er sie mit in sein Haus am Pankower Majakowskiring, hinter schwarzrotgoldenen Schlagbäumen. Welche Verse des russischen Revolutionsdichters der Übersetzerin in diesem Moment einfallen, ist klar. »Mein Sowjetpaß: Sesam öffne dich … Ich hebe ihn, und der VP oder Offizier, wahrscheinlich letzteres, gibt salutierend freie Fahrt. Im Presseklub, für den man einen Ausweis haben muß, zeige ich, nur als Experiment, stumm den roten Paß. Bitte sehr, die Dame. Nicht ganz in Ordnung.«
Und das Staunen geht weiter: »In seinem Haus gibt es ein Zimmer, er nennt es bescheiden ›mein Archiv‹. Es ist aber der Grundstock zu einem Bechermuseum mit Glasschautischen etc. Ich behielt mein ernstes Gesicht.«
Die Krankheit habe ihn sehr mitgenommen, erzählt er. »Aber dann suchte er sich ein Grab aus, neben Brecht, machte sein Testament und wurde ruhig. Das Grab habe ihn ruhig gemacht. Ich sagte: Gojim Naches. Aber er rührte mich sehr.«
Allmählich gewinnt sie den Eindruck, »daß er sich doch als alter Goethe fühlt«.
Für ihr Moskauer Leben scheint sich Becher weniger zu interessieren. »Wohnst du noch immer in dieser entsetzlichen Wohnung irgendwo da draußen?« fragt er sie einmal. »Eins hab ich begriffen«, notiert sie sarkastisch: »Man darf keinen deutschen Postsekretär in eine unserer Wohnungen lassen.«
Auffälligste Leerstelle in ihren Aufzeichnungen: Die »alten Wunden«, die traumatischen Erlebnisse der dreißiger Jahre in der Sowjetunion scheinen sie weitgehend beschwiegen zu haben. Wie viele Erklärungen sie einander noch schuldig gewesen sein mögen (sie hatte im Frühjahr 1942 nach seinem Suizidversuch die verbundenen Handgelenke gesehen): kein Thema mehr – oder immer noch keines.
»Ich muß nicht mehr schweigen«, hatte er unter dem Eindruck von Chruschtschows Rede geschrieben. »Ich brauche nicht das Gefühl zu haben, weiterhin mitschuldig zu werden dadurch, daß ich schweige. Es gilt nur noch die Sprache zu finden, um all das Ungeheuerliche beredt zu machen.« Ein Buch sei zu schreiben, »soll ich nicht weitere Schuld auf mich laden und mich durch irgendeine obskure Hintertür aus dem Leben hinausschwindeln«. Inzwischen hatte er diese Passagen aus den Korrekturfahnen seines »Poetischen Prinzips« wieder herausgestrichen. Und den enthaltenen Romanentwurf über einen 1937 im Moskauer Exil entstehenden Roman? So wenig, wie es ihn 1937 hätte geben können, würde es ihn 1957 ff. geben, das wußte Becher längst. Er stand schon vor besagter Hintertür, als Angarowa ihn traf.
Und sie selbst? Wo die Begegnung mit den »Genossen« der Moskauer Emigration sich nicht vermeiden ließ, umging sie diese Themen oder vertraute sie dem Tagebuch nicht an. Das erstaunt nicht, andere taten es genauso, viele schwiegen bis zuletzt. Angarowas Nachlaß enthält kaum einen Verweis auf die Vorgänge jener Zeit. Zu lange konnte die Aufbewahrung solcher Dokumente irreparable Folgen haben.
Erst im Mai 1989 äußerte sich Hilde Angarowa einmal im Gespräch mit zwei Filmemachern, Konrad Hermann und Hans Peter Klausnitzer, sehr markant über das, was damals geschehen war: »Es war, als ginge man auf einer ganz, ganz dünnen Eisdecke, und neben einem bricht einer durch. Und das Eis schließt sich wieder. (…) Wir haben gesagt: Wie schön ist jeder Tag, den du mir schenkst, Marie-Luise, das war damals ein Schlager in Deutschland – wobei wir mit Marie-Luise den NKWD meinten. So war das.« Der Film hieß »Die Angst und die Macht« und handelte von Johannes R. Becher.
In Berlin 1957 hat die Angarowa anderes im Sinn. Das Tagebuch spiegelt einen rauschhaft intensiven Monat, Hingabe an ein »geborgtes Leben«. Es gibt viel zu tun und noch mehr zu bedenken. Als erstes schafft sie sich die von der DSF bestellte Aufpasserin vom Leib, so resolut, daß sie Bewunderung erntet. Absolviert ein beachtliches Besuchsprogramm bei alten Bekannten ihrer Berliner Jugend (Lu Märten, Magdalene Müller-Martin, Grete Weiskopf, Gerhart Eisler), sucht die Begegnung mit Kunstschaffenden, die sie interessieren: Atelierbesuche bei dem Bildhauer Fritz Cremer, dem Architekten und Designer Franz Ehrlich, dessen Funkhaus in der Nalepastraße sie bewundert. Diskutiert wie nebenher mit den Kolleginnen und Kollegen bei »Kultur und Fortschritt«, Lektorat Sowjetliteratur, über »richtiges Übersetzen«, gibt dem DSF-Vorstand einen Nachhilfekurs zur neuesten Sowjetliteratur, speist in Bechers Beisein mit Klaus Gysi. Erlebt die Weigel als Mutter Courage im Berliner Ensemble und den Hauptmann von Köpenick Heinz Rühmann in den Zentrum-Lichtspielen Münzstraße. Das notdürftig hergerichtete Pergamonmuseum, die wieder in Betrieb genommene Nationalgalerie (»eine Freude, die Kokoschkas, Schmidt-Rottluffs, Feiningers … wenn auch teelöffelweise, wiederzusehen «), wo sie Lesser-Urys Nachtbilder für sich entdeckt. Im Regierungskrankenhaus läßt sie nach ihrer Tuberkulose sehen. (Böser Schreck, am Ende Entwarnung.)
Klammen Herzens besichtigt sie die Ruinen am Potsdamer Platz: »Und dann das Grausigste. Eine weite, unaufgeräumte Ansammlung riesiger Steinbrocken und Trümmer, starrend, schief übereinander getürmt, Wüstenei, unabsehbar. Gelber Granit, noch die Strebenform im Profil zu erkennen. Wertheim. Darüber zartrot, ins Lichtblau gehend, der Abendhimmel. Drunten schon zwielichtiges Dunkel in diesem Gewirr von Untergang, und über alldem fast unwirklich ganz rein und einsam in der Stille Vogelsang.«
Sie streift durch die Straßen, Cafés, betrachtet die »neuen Deutschen«, die alten und die jungen, findet sie erstaunlich nett. »Ich sehe bisher überhaupt nicht diesen Typ an nichts mehr glaubender, ausgehöhlter Zyniker wie so oft bei uns. Famose Menschen, ernst, dabei mit Humor und Kultur, sehr wohlerzogen, aber natürlich.« Manchmal muß sie ihre Euphorie regelrecht zügeln: »Ein höfliches aufgeschlossenes Völkchen, das nur alle Vierteljahrhundert seinen Vernichtungsrappel kriegt.« Sie inspiziert die neuen deutschen Kleider, die Wohnungen. Setzt die Honorare auf ihrem DM-Konto in Mode und Gebrauchsgüter um, fünf Koffer voll, für sich und die Lieben daheim. Und horcht bei alledem in sich hinein, wie sehr sie hier noch dazugehört. »Dort bin ich verzaubert«, stellt sie überrascht fest, »aber zu Hause bin ich hier … Fühle mich ganz hineingehörig, bloß einen Kopf größer.«
Ob hierzubleiben lohnte? In den letzten Tagebuch-Eintragungen spielt sie mit dem Gedanken, was wäre, wenn. »Wenn einem Menschen und Erlebnisse zufliegen und man wieder schmal, jung und elastisch, mit einem wunderbaren Körpergefühl im Wagen des Geliebten sitzt und die Buntheit Berlins und sein Frühlingsgrün an einem vorübergleiten …« Aber das ist, so weiß sie, eine Schimäre. Der Alltag würde anders aussehen. »Ellbogenbegabte Konkurrenz und das Zerren um den Knochen.« Sie fühlt sich von der Zunft geachtet, mitunter hofiert – und hat zugleich das Gefühl, bei der Auftragsvergabe hintanzustehen, den Abstand nicht mehr wettmachen zu können.
Ganz abgesehen von den Daheimgebliebenen: Tochter Nina, Enkel Sergej, den Moskauer Freunden – deutsche Bauhäusler, in der Sowjetunion gestrandet wie sie: die Fotografin Leoni Neumann-Labas, der Architekt Philipp Tolziner, der nach zehn Jahren Gulag in der DDR Arbeit zu finden gehofft hatte … Es ging wohl nicht. »Wieder einmal innerlich zwischen allen Stühlen wie in fast allen Grundfragen des Lebens.«
Mit Stephan Hermlin bespricht sie die Möglichkeit, zwischen beiden Ländern zu pendeln. Daraus wurde nichts.
»Bleib gesund, Hansel, und schon Dich, Du mußt älter als Goethe werden«, schreibt sie Becher zum Abschied. Auch das hat nicht geklappt. Anderthalb Jahre später wurde er pompös zu Grabe getragen, sie war nicht dabei. Die Angarowa blieb auf ihrem Moskauer Außenposten eine Übersetzerin russischer Literatur ins Deutsche, noch bis in die Wendezeit hinein. Sie starb 1999, mit einundneunzig Jahren.
Den nachfolgenden Text hat Hilde Angarowa unmittelbar nach dem Besuch in Cottbus, jener »Operation« am wehen Herzen mit Becher als Hilfssanitäter, in ihr Tagebuch geschrieben. Lediglich ein paar Absätze wurden zur besseren Lesbarkeit eingefügt.
Andreas Tretner
(…)
SINN UND FORM 3/2021, S. 392-401, hier S. 392-397
