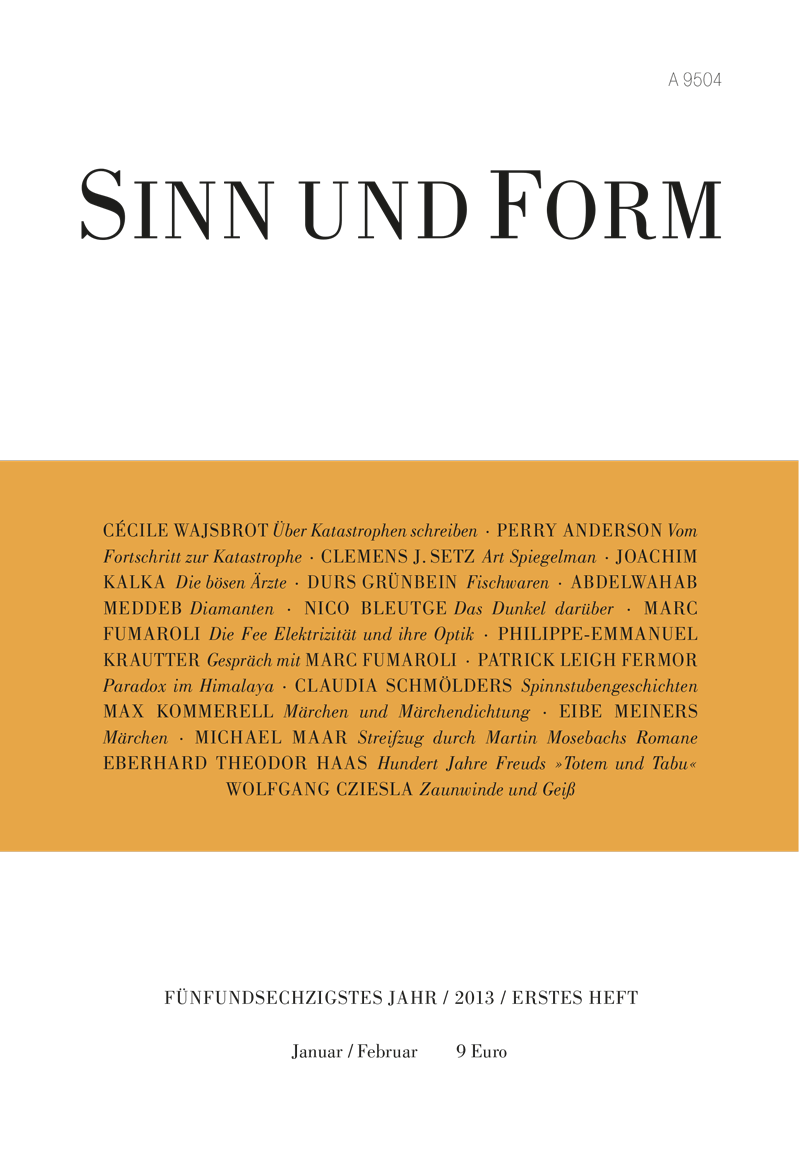Leseprobe aus Heft 1/2013
Wajsbrot, Cécile
Über Katastrophen schreiben
»Du bittest mich, Dir das Ende meines Onkels zu schildern, damit Du es desto wahrheitsgetreuer der Nachwelt überliefern kannst. Ich danke Dir; denn ich sehe, daß seinem Tod, wenn er von Dir beschrieben wird, unsterblicher Nachruhm bestimmt ist. Denn obwohl er bei der Verheerung der schönsten Landstriche, wie die Bevölkerung, wie ganze Städte, den Tod fand und wie sie durch diese denkwürdige Katastrophe gleichsam ewig leben wird und obwohl er selbst viele bleibende Werke verfaßt hat, wird die Unvergänglichkeit Deiner Schriften doch viel zu seinem Fortleben beitragen.«
So beginnt der Brief Plinius’ des Jüngeren an Tacitus, in dem er vom Tod seines Onkels Plinius des Älteren, des Autors der »Naturgeschichte«, durch den Vesuvausbruch im Jahr 79 berichtet, bei dem Pompej verschüttet wurde. Es sei, schreibt er, eine Pflicht, die näheren Umstände zu schildern. Eine Gedenkpflicht, würde man heute sagen.
Man weiß nicht genau, von wann der Brief stammt. Die Ereignisse im sechsten Buch seiner Briefe legen nahe, daß er um 106/107 unserer Zeitrechnung geschrieben wurde, also etwa dreißig Jahre nach dem Vorfall. Eine Art nachgereichtes Zeugnis.
Denn alles spricht dafür, daß der Bericht wahrhaftig ist. Tacitus hatte Plinius um den Gefallen gebeten, damit er die Vorfälle »desto wahrheitsgetreuer der Nachwelt überliefern« könne. Die nachfolgende Erzählung verbindet die Schilderung der Todesumstände von Plinius dem Älteren mit Beschreibungen des Vesuvausbruchs.
»Die Wolke erhob sich – aus welchem Berg, konnte man aus der Entfernung nicht deutlich erkennen; daß es der Vesuv war, erfuhr man erst später.« Das Zeugnis ist noch ungenau, Eindrücke werden beschrieben, aber der Name, der Echtheitsnachweis des Historikers, fehlt noch, denn wegen ihrer Nähe lassen sich zeitgeschichtliche Ereignisse nur selten namentlich benennen. »Ihre Erscheinungsform veranschaulicht wohl kein Baum besser als die Kiefer. Denn sie wuchs wie in einem sehr langen Stamm in die Höhe und breitete sich dann in mehreren Ästen aus.« Wieder kommt der Name später – und was für einer, heißt diese Art Eruption doch seither und bis heute die Plinische.
»Ich glaube, weil sie durch einen kräftigen Aufwind emporgerissen wurde und sich dann, als dieser nachließ, kraftlos oder auch unter der Last ihres eigenen Gewichts in die Breite ergoß. Bisweilen war sie weiß, bisweilen schmutzig und fleckig, je nachdem sie Erde oder Asche mitgerissen hatte.«
Beim Lesen dieser Sätze und anderer, die folgen – »schon fiel Asche auf die Schiffe, und je näher sie herankamen, desto heißer und dichter, schon Bimssteine und sogar schwarzgebrannte und durch Feuer geborstene Steine; schon bildeten sich plötzliche Untiefen, und der Strand war durch Geröll-Lawinen vom Berg unzugänglich« – kommt man nicht umhin zu denken, daß das schön ist. Alles läuft wie in einem Film ab, in Schwarzweiß und in Farbe. Meer, Asche, Erde – der Krieg der Elemente. Für uns, die wir es heute lesen, ist das fast zweitausend Jahre her, man denkt nicht mehr an die Toten vom Pompej, die auch ohne Vesuvausbruch schon lange tot wären. Der zeitliche Abstand tut seine Wirkung, macht gleichgültig, lenkt den Blick auf die Form – keiner von uns hat unmittelbar damit zu tun, kein Verwandter kam zu Tode. Doch vielleicht ertappt man sich bei heutigen Ereignissen, bei bestimmten Fotos aus Haiti nach dem Erdbeben, bei ähnlichen Gedanken. Die Bildeinstellung, die Farben – schon ist das unmittelbare Zeugnis verwischt, eine Inszenierung, ein Standpunkt werden sichtbar. Wieder ein Abstand, diesmal ein räumlicher, der analog zum zeitlichen wirkt. Wurden solche Fotos in haitianischen Zeitungen gedruckt? Die Unmittelbarkeit des Zeugnisses ist verwischt, die Reportage stellt Abstand her – nicht umsonst kann das Wort auch aufschieben, vertagen heißen.
In seinem 1766 erschienenen »Laokoon« nimmt sich Lessing vor, ausgehend von der im Rom der Renaissance wiederentdeckten antiken Laokoon-Gruppe die Grenzen von Malerei und Poesie – oder besser, Bildender Kunst und Literatur – abzustecken. Er wendet sich in erster Linie gegen Winckelmann, der wie andere vor ihm bemerkt hatte, daß Laokoons Gesicht, anders als sein Körper, nur verhaltenen Schmerz ausdrücke. Laokoon schreit nicht: Weil er den Schmerz zu bezwingen weiß, sagt Winckelmann; also aus Charakterstärke. Weil die Darstellung des Schreis sein Gesicht entstellt und ihn häßlich gemacht hätte, sagt Lessing; also aus ästhetischen, nicht aus ethischen Gründen. Die Kunst strebe nach dem Schönen, selbst wenn sie Leiden darstelle. Wäre Laokoons Schmerz realistisch dargestellt, sähe man weg. Zudem, fährt Lessing fort, müsse die Kunst der Einbildungskraft freies Spiel lassen. Der Maler Timomachus malte Medea nicht, wie sie ihre Kinder tötet, sondern kurz davor, als ihre mütterliche Liebe noch mit ihrer Eifersucht kämpft. Er malte den Konflikt, die Ambivalenz – die von größerer dramatischer Intensität sind als die nackte Tat –, und darum zittert der Betrachter des Freskos beim Gedanken an das Kommende wie der Zuschauer eines Films, wenn die Musik anschwillt und ein Drama ankündigt.
Und da eines der Themen von Lessings »Laokoon« der Unterschied zwischen Malerei und Poesie ist, verweilt er bei der Beschwörung Laokoons im Zweiten Buch von Vergils »Äneis«. Vergil schildert seinen Kampf mit den beiden Wasserschlangen, die erst seine Söhne und dann ihn angreifen. Was die Bildende Kunst gleichzeitig, in einem Bild darstellt, zeigt die Literatur als Abfolge. Der Kunst des Raumes steht die Kunst der Zeit gegenüber. »Schon haben sie zweimal seine Mitte umfaßt, zweimal um seinen Hals die schuppigen Rücken gelegt, sie erheben steil ihren Kopf und Nacken. Er sucht mit den Händen die Knoten zu lösen, seine Priesterbinden sind von Geifer und schwarzem Gift befeuchtet, und er sendet furchtbares Geschrei zum Himmel.« Die Beschreibung wirkt statisch, ist es aber eigentlich nicht. Diesen schreienden Laokoon, erklärt Lessing, haben wir schon anders gesehen, als liebenden Vater, als Patrioten, der Troja vergeblich zu verteidigen sucht. Wenn wir ihn schreien sehen, mischen sich Bilder aus seiner Vergangenheit hinein, machen ihn menschlich und uns ähnlich – statt ihn durch eine monströse Darstellung des Schmerzes zu entmenschlichen –, und er wird zum Symbol des Schicksals.
Plinius beschreibt den Vesuvausbruch nicht, weil Tacitus sich nach ihm erkundigt, sondern weil dieser die Todesumstände Plinius’ des Älteren erfahren will. Manche haben die Echtheit der Briefe in Zweifel gezogen. Da Plinius Teile seiner Korrespondenz zu Lebzeiten veröffentlichte und keine Antwortbriefe überliefert sind, überlegten sie, ob er die Briefform nicht benutzte, um fingierten Adressaten zu schreiben, realen Personen, für die sie aber nie bestimmt waren. Wenn es auch möglich und sogar wahrscheinlich ist, daß Plinius seine Briefe für die Veröffentlichung überarbeitet hat, so gibt es doch keinen Grund, an ihrer Echtheit und damit an der Bitte des Tacitus zu zweifeln. Nicht die Naturkatastrophe ist also der Auslöser des Textes, sondern ein Einzelschicksal, der Tod eines Mannes, der aus wissenschaftlicher Neugier und um andere zu retten zu lange und zu dicht an Orten blieb, die er hätte fliehen sollen. Und doch eröffnen der sechzehnte und der ergänzende zwanzigste Brief des Plinius eine lange, Jahrhunderte und Kontinente überspannende Reihe von Texten, die von geschichtlichen und Naturkatastrophen künden. Gewiß, es gab die »Ilias«, in der Homer den Trojanischen Krieg besang und Schlachten schilderte, doch dieses Epos war als Verherrlichung des Heldentums gedacht und präsentiert sich als Ursprungserzählung. Als Erzählung von Siegern. Beim Vesuvausbruch gibt es weder Sieger noch Besiegte, oder vielmehr, es gibt nur Besiegte; einige haben überlebt, andere nicht, aber jeder hat etwas verloren. Eine lange Reihe von Verlusterzählungen hebt an: angefangen mit dem Erdbeben von Lissabon, das den Philosophenstreit des 18. Jahrhunderts über die Vorsehung bestimmte, wie u. a. Voltaires Gedicht zeigt, über das Erdbeben in Chili, das Kleist zu einer Novelle anregte, und die Katastrophe von Tschernobyl, die Swetlana Alexijewitsch beschrieben hat, bis hin zu den jüngsten Texten haitianischer Schriftsteller nach dem Erdbeben 2010. Auch die Schilderung des großen Erdbebens 1905 in Japan durch den damaligen französischen Botschafter Paul Claudel wäre zu nennen. All die Science-Fiction-Romane über Verheerungen durch Natur- oder Atomkatastrophen oder rätselhafte Krankheiten, wie Jack Londons »Scharlachrote Pest«. Bücher über geschichtliche Katastrophen, wie Kenzaburo Oes »Notizen aus Hiroshima«. Oder Chaim Nachman Bialiks bedeutendes Gedicht »In der Stadt des Tötens« über die Pogrome 1903 in Kischinew. Und jene, fast hätte ich gesagt, Ur-Katastrophe, was sie chronologisch gesehen gar nicht ist, die man auf den Begriff Auschwitz bringen kann. Doch dieser Name wirft einen zu großen Schatten, verbreitet die schwarze Aura des Grauens und verdammt zum Schweigen, zu wirren, ungreifbaren, widersprüchlichen Gedanken; dafür gibt es keinen Maßstab, keinen Vergleich; Adornos aus dem Zusammenhang gerissener, tabugespickter Satz von der Unmöglichkeit, nach Auschwitz Gedichte zu schreiben, wo doch zur selben Zeit Paul Celan schrieb. Doch darüber wurde schon so viel gesagt, daß ich die Sache anders angehen möchte, wenn man ihr schon nicht ausweichen kann. Hat Imre Kertész nicht geschrieben, auch wenn ich nicht von Auschwitz spreche, spreche ich von Auschwitz?
1979 veröffentlicht der in Frankreich verkannte deutsche Philosoph Hans Blumenberg sein Buch »Schiffbruch mit Zuschauer«. Wegen seiner jüdischen Mutter durfte der 1920 in Lübeck Geborene und 1996 Verstorbene nicht wie vorgesehen als bester Schüler seines Abiturjahrgangs eine Rede halten und konnte später auch sein Studium nicht zu Ende führen. Von den Kommilitonen diskriminiert, fand er eine Stelle als Verkäufer und wurde 1945 in ein Arbeitslager deportiert, aus dem er fliehen konnte. Nach dem Krieg nahm er sein Studium – Philosophie, Germanistik, Klassische Philologie – wieder auf und schlug eine Universitätslaufbahn ein. In seinem reichhaltigen Werk untersucht er u.a. Metaphern und ihre metaphysischen Substrate und vermerkt deren Präsenz in der Welt. Den Schiffbruch mit Zuschauer zum Beispiel. Die westliche Philosophie, erläutert Blumenberg, betrachtet die menschliche Existenz als Überfahrt. Es wimmelt von Metaphern, die aus der Vorstellungswelt der Seefahrt schöpfen, selbst in Ländern ohne Zugang zum Meer. Sturm, Erreichen des sicheren Hafens, Schiffbruch, Insel des Friedens, Wogen … Der Philosoph betrachtet die Wirklichkeit wie ein Zuschauer, der vom Festland den Kampf eines anderen mit dem sturmgepeitschten Meer verfolgt. Aus der Beobachterposition heraus wird er zum Zeugen. Doch der Zeuge kann den Boden unter den Füßen verlieren und sich in die Lage des Schiffbrüchigen einfühlen, also selbst die Erfahrung des Schiffbruchs machen. Vielleicht ist das die Brücke zwischen Philosophie und Literatur. In dem Brief über den Vesuvausbruch und den Tod seines Onkels ist Plinius dieser Zuschauer, der dem Schiffbruch beiwohnt und ihn vom Festland aus beschreibt. Eine fingierte oder besser gesagt konstruierte Position, die der andere, der zwanzigste Brief Lügen straft. Diesmal wollte Tacitus wissen, wie Plinius selbst die Katastrophe erlebt habe. Hier nun die gleiche Szene noch einmal, mit Übereinstimmungen und Abweichungen:
»Bebt auch schaudernd das Herz mir zurück bei dieser Erinnerung …«. Der Bericht ist von Beginn an subjektiv, während der frühere im Zeichen der Objektivität stand. Wieder zeichnet sich ein steter Wechsel ab, diesmal zwischen einer diskreten Innensicht und dem Versuch zu beschreiben. Doch die Beschreibung ist viel konkreter als im ersten Brief. Hieß es in jenem: »Schon bildeten sich plötzliche Untiefen, und der Strand war durch Geröll-Lawinen vom Berg unzugänglich«, so heißt es nun: »Außerdem sahen wir, daß sich das Meer in sich selbst zurückzog und durch das Erdbeben gleichsam zurückgedrängt wurde: jedenfalls hatte sich die Küstenlinie weiter vorgeschoben und hielt viele Meerestiere auf dem trockenen Sand fest. Auf der anderen Seite eine schwarze, grauenerregende Wolke, von züngelnden und aufschießenden Streifen feuriger Lohen durchzuckt, die in langen Flammenerscheinungen aufriß: Blitzen waren sie ähnlich, nur größer.« Eine Erregung kommt zum Vorschein, die im ersten Brief fehlte. Ängste, auf die nur angespielt wurde (die »verstörte Menschenmenge«), werden nun ausführlich beschrieben. »Die einen suchten mit ihren Stimmen die Eltern, andere ihre Kinder, andere ihre Ehefrauen und suchten sie an der Stimme zu erkennen; diese klagten über ihr eigenes, jene über das Schicksal ihrer Angehörigen; da waren welche, die in ihrer Todesangst den Tod erflehten; viele hoben die Hände zu den Göttern, andere meinten, es gäbe schon nirgends irgendwelche Götter mehr und dies sei die ewige und letzte Nacht für die Welt.« Hinter den dargestellten Verhaltensweisen erscheint die universelle Angst, das Signum der Katastrophe. Der Erzähler ist davon nicht frei und kann es auch nicht sein, sonst hätte sein Zeugnis keinen Sinn. Der wesentliche Unterschied zum ersten Brief besteht im Gebrauch zweier grammatischer Personen, der Ersten Person Singular und der Ersten Person Plural; denn obgleich sich Plinius schon im ersten Brief kurz ins Spiel brachte, berichtete er überwiegend in der Dritten Person. Die Grenze zwischen äußerem und innerem Erleben verschwimmt. Alles erscheint aus einer einheitlichen und subjektiven Perspektive, der Erzähler wird mal zur Stimme seines eigenen Bewußtseins, mal zum Sprecher eines Kollektivs.
1807 erscheint Kleists Novelle »Das Erdbeben in Chili«, deren Handlung verwickelt ist. Eine junge Frau, Josephe, hat mit ihrem Hauslehrer Jeronimo einen Fehltritt begangen, wird ins Kloster geschickt und kommt ausgerechnet bei einer Prozession der Novizinnen nieder. Sie wird zum Tod verurteilt, er muß ins Gefängnis. Es kommt der Tag ihrer Hinrichtung, an dem Jeronimo sein Leben selbst beenden will. »Eben stand er (…) an einem Wandpfeiler und befestigte den Strick, der ihn dieser jammervollen Welt entreißen sollte, an eine Eisenklammer, die an dem Gesimse derselben eingefugt war; als plötzlich der größte Teil der Stadt, mit einem Gekrache, als ob das Firmament einstürzte, versank, und alles, was Leben atmete, unter seinen Trümmern begrub.« Es ist das Erdbeben in Chili. Jeronimo kann auf wundersame Weise fliehen und will nur eines wissen: Ist die Hinrichtung erfolgt? Er durchstreift die verwüstete Stadt auf der Suche nach Josephe, nach einer Antwort. »Hier stürzte noch ein Haus zusammen, und jagte ihn, die Trümmer weit umherschleudernd, in eine Nebenstraße; hier leckte die Flamme schon, in Dampfwolken blitzend, aus allen Giebeln, und trieb ihn schreckenvoll in eine andere; hier wälzte sich, aus seinem Gestade gehoben, der Mapochofluß auf ihn heran, und riß ihn brüllend in eine dritte. Hier lag ein Haufen Erschlagener, hier ächzte noch eine Stimme unter dem Schutte.«
Worin besteht der Unterschied zwischen dieser Beschreibung des Verderbens und der von Plinius? Auch hier ist der Standpunkt konstruiert, aber nicht als der einer realen Person, sondern einer literarischen Figur. Die Zutaten, um es salopp zu sagen, sind fast dieselben: einstürzende Mauern, ein über die Ufer tretender Fluß, Flammen und Rauchwolken, doch derjenige, dem sich dieses Bild der Verwüstung bietet, ist Jeronimo, ein Gespenst, das soeben dem Tod entgangen ist, während alles um ihn stirbt. Diese besondere und paradoxe Situation rechtfertigt die Beschreibung und verleiht ihr Nachdruck. Die geschilderte Katastrophe ist Teil einer Geschichte, die vorher begann und danach weitergeht, so daß der Leser empathisch reagieren kann. Doch obwohl der Titel, die Namen und die Jahreszahl 1647 auf das Erdbeben in Chili verweisen, gab es in Santiago seinerzeit weder Flammen noch Überschwemmung. Das beschriebene Erdbeben ähnelt vielmehr dem von Lissabon 1755, das für Kleist näher lag. Wie bei den von Freud beschriebenen Mechanismen des Traums kommt es zu Verdichtung und Verdrängung, Merkmale des weit spektakuläreren Erdbebens von Lissabon werden in die Atmosphäre von Santiago im siebzehnten Jahrhundert verpflanzt, um das gewünschte dramatische Zusammentreffen von Naturkatastrophe und religiöser Unterdrückung und Intoleranz zu bewerkstelligen.
Nach stundenlangem Umherirren entdeckt Jeronimo Josephe an einer Quelle. Sie ist mit ihrem Kind dem brennenden Kloster entkommen. Die Geliebten finden sich wieder, »im Tale, und Seligkeit, als ob es das Tal von Eden gewesen wäre«. Es folgt eine idyllische Zeit, eine Art ursprüngliches Leben fern der Welt – ein verlorenes und wiedergefundenes Paradies – mit Don Fernando, dem Sohn des Gouverneurs der Stadt und seiner Familie. Zwar sind die Anzeichen der Katastrophe gegenwärtig – Kleist expliziert Gerüchte über das in der Stadt ausgebrochene Chaos sowie über Plünderungen und Exekutionen –, die Menschen werden körperlich und seelisch geprüft, doch in dieser vertrauten begünstigten Gesellschaft walten Zuneigung und Großmut. Dachten sie zunächst daran, nach Spanien ins Exil zu gehen, so wollen Jeronimo und Josephe nun den Vizekönig um Vergebung bitten. Eine Messe soll gefeiert werden, und die Liebenden nehmen teil in der Hoffnung, diese zu erlangen. In der Predigt werden die Schrecken des Jüngsten Gerichts heraufbeschworen, die Katastrophe wird als Strafe für die Sittenverderbnis der Stadt gedeutet. Der Chorherr erwähnt bei dieser Gelegenheit »umständlich des Frevels (…), der in dem Klostergarten der Karmeliterinnen verübt worden war« und zur Verurteilung der Liebenden führte. Die Angeklagten versuchen zu fliehen, nach verschiedenen Wendungen wähnt man sie schon in Sicherheit, da werden Josephe und Jeronimo nacheinander von der aufgebrachten Menge erschlagen. Wozu also die erste Rettung? Die verhinderte Hinrichtung? Der Aufschub? Erzählerisch ist der Schluß gerechtfertigt, denn der Aufbau ist dreiteilig: Hinrichtung – Rettung – Hinrichtung. Das Vorbild, die Tragödie, kennt die Unausweichlichkeit des Schicksals: Was immer geschieht, niemand entgeht seinem Los. Etymologisch bedeutet Katastrophe Umwälzung, Umsturz, und bezeichnet die letzte Episode einer Tragödie, den letzten Akt, die Lösung des Konflikts. Im ersten Buch seiner »Charaktere« (»Von den Schöpfungen des Geistes«) definiert La Bruyère die Tragödie wie folgt: »Die echte tragische Dichtung beengt uns das Herz von Anfang an, läßt uns in ihrem Verlauf kaum die Zeit, zu atmen und wieder zu uns zu kommen; oder sie gibt uns einen Augenblick frei, nur um uns in neue Abgründe und neue Beängstigungen zu stürzen. Sie führt uns durch Mitleid zum Schrecken oder umgekehrt durch Schrecken zum Mitleid; reißt uns durch Tränen, durch Schluchzen, durch Ungewißheit, durch Hoffnung und Furcht, Überraschung und Grauen bis zur Katastrophe.«
Somit enthält Kleists kurze Novelle alle Facetten des Begriffs Katastrophe. Sie ist seine zu Literatur gewordene etymologische Bedeutung. Dazu kommt der heute übliche Gebrauch des Worts im individuellen wie im kollektiven Sinn. Genau hier, wo sich die Hauptstraße des Kollektiven und der Pfad des Individuellen kreuzen, ist der Raum, der Ort des Erzählens. Wäre die Katastrophe allumfassend, gäbe es keinen Bericht davon. Damit er zustande kommt, braucht es einen Überlebenden, den Schreiber, und eine Gemeinschaft von Überlebenden oder Verschonten, an die er sich wendet.
Zwei Jahre nach »Robinson Crusoe« erscheint 1722 ein Buch von Daniel Defoe mit dem ebenso schlichten wie trügerischen Titel »Tagebuch des Pestjahrs «. 1665/ 66 raffte die Pest in sechs Monaten 40000 Londoner dahin. Das Ausmaß solcher Epidemien ist schwer vorstellbar. Zwischen 1348 und 1352 starben in Europa 24 Millionen Menschen an der Pest, ein Viertel der Bevölkerung. Weitere Epidemien folgten, bis man Anfang des 19. Jahrhunderts den Krankheitsüberträger – nicht die Ratte, wie man geglaubt hatte, sondern den Rattenfloh – und auch den Impfstoff fand. Doch die Jahrhunderte der Angst, mit Höhepunkten, mehr oder weniger großflächigen Pandemien, hatten sich so tief ins kollektive Gedächtnis eingesenkt, daß manche literarischen Katastrophenbücher sie mehr oder weniger explizit zum Vorbild nahmen, wie Jack Londons »Rote Pest« (1915) oder Matthew Phipps Shiels »Purpurne Wolke« (1901), die beide von der völligen Verwüstung der Erde handeln. Bei Jack London haben nur wenige in einem vom Rest der Welt abgeschnittenen Amerika überlebt, bei Shiel nur zwei in England (seltsamerweise stammen die Überlebenden stets aus dem Heimatland des Autors). Werke, die man als Science-fiction bezeichnen könnte und in deren Mittelpunkt jedesmal der unerläßliche überlebende Erzähler steht, oder Werke mit politischer Intention, in denen die Pest – wie in Camus’ Roman – als Metapher für ein diktatorisches Regime steht, wurden Faschismus und Nazismus doch oft »braune Pest« genannt. Um zu begreifen, wie tief die Furcht vor Epidemien und Pandemien noch heute sitzt, braucht man sich nur die Angst zu vergegenwärtigen, die im Herbst 2009 um sich griff, als eine Welt, die rationaler und aufgeklärter als das Mittelalter oder das siebzehnte Jahrhundert sein will, mit dem Eintreffen des H1N1-Virus rechnete. Defoe war fünf, als die Pest in London wütete, und er wurde zweifellos durch die Grabesstimmung und durch Erzählungen geprägt, die er gehört haben muß. Wie sind seine Familie und er selbst davongekommen? Man weiß es nicht. Aber ist es Zufall, daß sein berühmter »Robinson Crusoe« die Geschichte eines Überlebenden ist? Gewiß, eine wahre Begebenheit hat ihn dazu angeregt, doch unabhängig von der Geschichte jenes schottischen Seemanns, der vier Jahre nach seinem Schiffbruch auf einem öden Eiland aufgefunden wurde, hatte Defoe die existentielle Situation des Überlebenden selbst erfahren, und sie bestimmte seine Sicht der Welt. Im »Tagebuch des Pestjahrs« ist der wie üblich in der ersten Person erzählende überlebende Zeuge ein Londoner Kaufmann. Das Gerücht läuft um, ein Sperrgürtel solle um die Stadt gelegt werden, und der Erzähler fragt sich, ob er aufs Land gehen oder bleiben soll. Widrige Umstände, in denen er ein Zeichen der Vorsehung sieht, halten ihn fest, und für sein Bleiben erhält er das implizite Versprechen, verschont zu werden. Auf gut Glück in der Bibel blätternd, stößt er auf den 91. Psalm: »Es wird dir kein Übel begegnen, und keine Plage wird zu deiner Hütte sich nahen.«
Der Erzähler ist geblieben, um Zeugnis abzulegen. Er schreibt auf, was er wahrnimmt: die Angst der Menschen, die Schreie, die man in den verlassenen Straßen hört – »eine ganze Familie war in furchtbarer Aufregung, und ich konnte hören, wie Frauen und Kinder wie außer sich durch die Zimmer liefen« –, das Lesen der Zeichen, das Erscheinen eines Kometen, die Orakel und Weissagungen der Astrologen, Bestattungen. Der Bericht wechselt ab mit Totenlisten aus Kirchenbüchern, Einzelheiten über die ergriffenen Gegenmaßnahmen – Verbot öffentlicher Darbietungen und Bankette, Ahndung von Trunkenheit, Entfernung von Unrat – und moralischen oder philosophischen Betrachtungen. Der Erzähler vermerkt, daß der nach Oxford geflüchtete Hof verschont wurde, und fügt hinzu: »Ich kann freilich nicht sagen, daß ich bei ihnen je große Anzeichen von Dankbarkeit dafür bemerkt hätte, und kaum etwas von einer Sinnesänderung, obgleich es nicht ausblieb, daß man ihnen nachsagte, (…) ihre schreienden Laster könnten für das Hereinbrechen dieses furchtbaren Strafgerichts über die ganze Nation verantwortlich gemacht werden.« Zudem sind Ratschläge eingestreut, ja sogar Tadel für die Art und Weise, wie die Krise von der Obrigkeit gehandhabt wurde. Wie Kleist mit dem Erdbeben in Chili eigentlich das von Lissabon meint, kann nämlich auch die eine Pest für die andere stehen. Als Defoe 1720 sein Tagebuch beginnt, bricht in Marseille die Pest aus, und man fürchtet ihre Ausbreitung bis London. Das schärft den Sinn fürs Überleben. Da ihn die Vorsehung 1665 verschont hat, kann der Kaufmann durch sein Zeugnis dazu beitragen, daß die gleichen Ursachen nicht wieder zu den gleichen Wirkungen führen. Oft verbinden die Zeugen, die Überlebenden, mit ihrem Bericht eine Vorstellung von Nützlichkeit – Zeugnis ablegen, damit sich die Katastrophe nicht wiederholen möge. Mag sie zunächst als Rechtfertigung des Zeugnisses, des Verfassens dieser oder jener Schrift erscheinen, so ist sie doch – auf untergründige, verborgene Weise – auch Rechtfertigung des Überlebens, der Existenz des Autors, der so die Schuld zu leben, wo doch alle anderen starben, kompensiert und seinem Überleben einen Sinn gibt. Das Zeugnis weitet sich auf alles aus, was der Überlebende tut und schreibt, es geht in seine Person ein.
»Tagebuch des Pestjahrs« – der Titel läßt auf einen Zeugenbericht schließen, während das abgekartete Spiel mit einem erwachsenen Erzähler, der Kaufmann ist, und einem Autor, der nie Kaufmann war und zum Zeitpunkt des Geschehens fünf ist, auf einen Roman hindeutet. Tatsächlich wurde das Buch als Fiktion aufgefaßt: »Dieser Bericht ist sehr wohl ein Roman, obgleich er für ein historisches Dokument gehalten wurde«, schreibt Joseph Aynard im Vorwort zu seiner Übersetzung von 1943 (übrigens ein merkwürdiges Erscheinungsjahr für dieses Buch). Dagegen schreibt Henri Mollaret, Professor am Institut Pasteur, einem biomedizinischen Forschungszentrum, in seinem Vorwort zur Folio- Ausgabe: »Nichts ist erfunden an dem Bericht Defoes, dessen ›Tagebuch‹ sicherlich die umfassendste, genaueste Beschreibung der Pest darstellt.« Um vorläufig abzuschließen, möchte ich noch einmal auf Plinius’ ersten Brief zurückkommen, der so endet: »Als einziges will ich noch beifügen, daß ich alles, was ich selbst erlebt oder gehört habe, unter dem unmittelbaren Eindruck aufgezeichnet habe, wenn man die Ereignisse am treuesten erzählt. Du wirst das Wichtigste herausziehen, denn es ist nicht dasselbe, ob man einen Brief oder eine Geschichte schreibt, ob man einem Freund oder ob man für die Nachwelt schreibt.« Mit Geschichte ist ein Geschichtsbuch und kein fiktionales Werk gemeint; und die Nachwelt ist eine Extrapolation des Übersetzers, denn im lateinischen Text steht omnibus, womit das Schreiben an einen Freund dem für die Allgemeinheit, und das Private dem Öffentlichen, gegenübergestellt wird.
Doch das Schicksal – oder die Geschichte – hat Sinn für Ironie. Tacitus’ Bericht vom Vesuvausbruch und vom Tod Plinius’ des Älteren hätte in seine »Historien « der Jahre 69 bis 96 Eingang finden sollen. Die überlieferten Bücher hören aber 70 auf. Wie gingen sie verloren? Wurden sie überhaupt geschrieben? Wie ist der Rest auf uns gekommen? So viele Fragen ohne Antwort. Die Nachwelt erfuhr die Einzelheiten des Vesuvausbruchs letztlich nicht durch den öffentlichen Bericht des Tacitus, sondern über den privaten des Plinius.
Aus dem Französischen von Gernot Krämer
SINN UND FORM 1/2013, S. 5-14