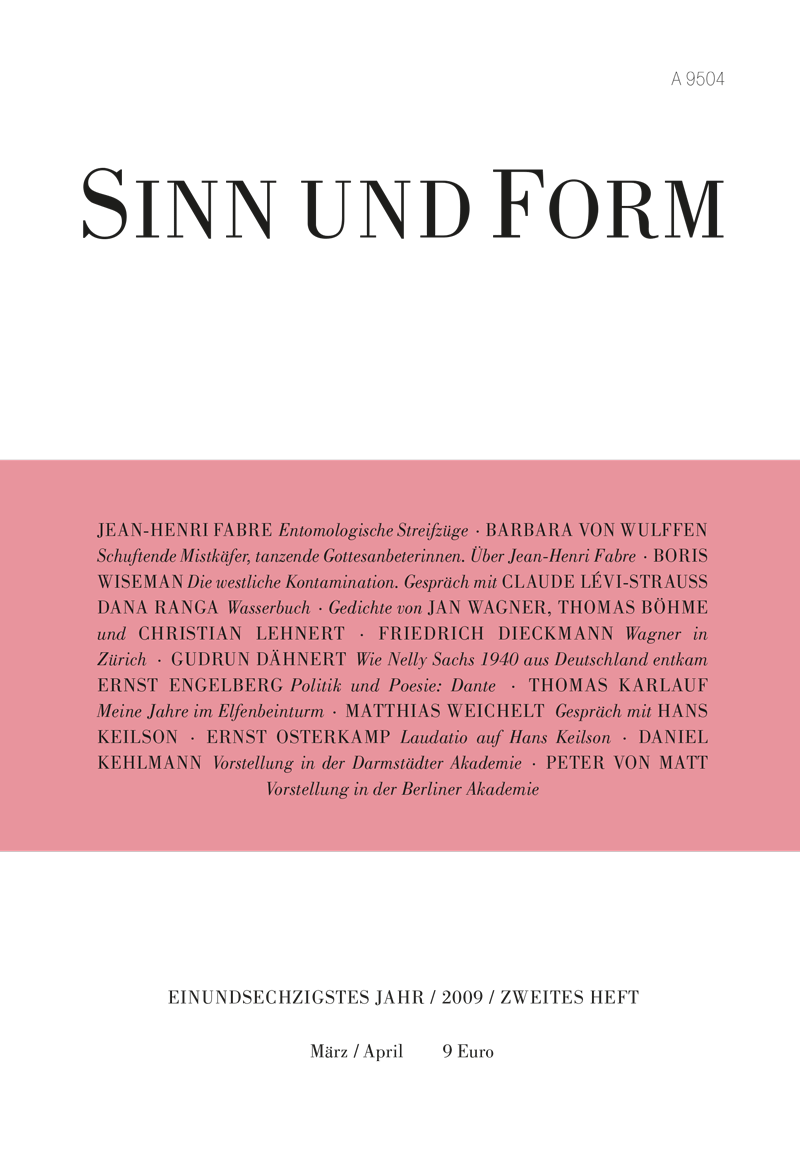
Printausgabe vergriffen
Heft 2/2009 enthält:
Fabre, Jean-Henri
Entomologische Streifzüge, S. 149
Die Languedoc-Grabwespe Wenn der Chemiker sein Experiment reiflich geplant hat, mischt er seine Reagenzien, wann es ihm am besten paßt, und (...)
Wulffen, Barbara von
Schuftende Mistkäfer, tanzende Gottesanbeterinnen. Über Jean-Henri Fabre, S. 167
Wiseman, Boris
Die westliche Kontamination. Gespräch mit Claude Lévi-Strauss, S. 180
BORIS WISEMAN: Sie gelten heute als Klassiker, und nicht selten reiht man Sie unter die größten Denker unserer Zeit ein. Was bedeutet Ihnen (...)
Ranga, Dana
Wasserbuch, S. 186
Wagner, Jan
Gedichte, S. 191
Böhme, Thomas
Gedichte, S. 196
Lehnert, Christian
Gedichte, S. 200
Dieckmann, Friedrich
Die postrevolutionäre Zuflucht, S. 206
Dähnert, Gudrun
Wie Nelly Sachs 1940 aus Deutschland entkam. Mit einem Brief an Ruth Mövius, S. 226
Engelberg, Ernst
Politik und Poesie: Dante, S. 258
Karlauf, Thomas
Meine Jahre im Elfenbeinturm, S. 262
I Die Fahrkarte habe ich aufgehoben. Das kleine ockerfarbene Pappstück, 3 x 5,5 cm, liegt in meiner Devotionalienschachtel: einfache Fahrt 2. (...)
Weichelt, Matthias
Gespräch mit Hans Keilson, S. 273
MATTHIAS WEICHELT: Herr Keilson, Sie wurden 1909 in Bad Freienwalde bei Berlin geboren und emigrierten in den dreißiger Jahren nach Holland. Sie (...)
Osterkamp, Ernst
Laudatio auf Hans Keilson, S. 277
Kehlmann, Daniel
Selbstvorstellung, S. 281
Matt, Peter von
Selbstvorstellung, S. 282
Meine Damen und Herren, in der Literatur beschäftigen mich Sätze, und es beschäftigen mich Konflikte. Einerseits also die kleinste, (...)
