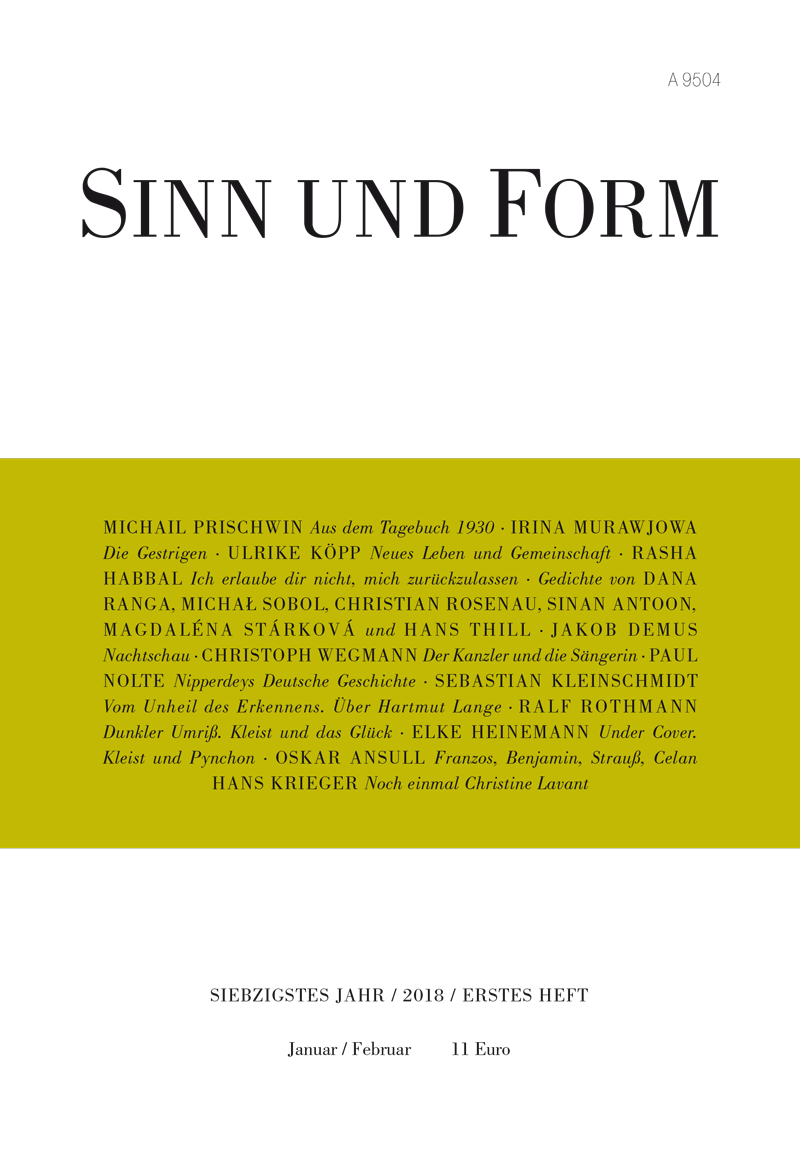Heft 1/2018 enthält:
Prischwin, Michail
»Glücklich unsere Erben, die unsere Zeit nur lesen werden.« Aus dem Tagebuch 1930. Mit einer Vorbemerkung von Eveline Passet, S. 5
Vorbemerkung
Ich kann der Gesellschaft nur aus einem Abstand zu ihr in versunkenem Nachdenken nützlich sein.
1. Juni 1928
Wie soll man (...)
Ranga, Dana
Cosmos! Gedichte, S. 28
Murawjowa, Irina
Die Gestrigen, S. 33
Sobol, Michal
Herr Orkusz. Gedichte, S. 42
Köpp, Ulrike
Neues Leben und Gemeinschaft. Zum Reformstreben in der Moderne, S. 46
Die Stalinallee, jene für ihre Architektur bewunderte wie verhöhnte Prachtstraße in der östlichen Mitte Berlins, ist eine Chiffre für den (...)
Rosenau, Christian
Helden sagen. Gedichte, S. 61
Habbal, Rasha
Ich erlaube dir nicht, mich zurückzulassen, S. 65
Antoon, Sinan
Die schmale Stelle am Tor. Gedichte, S. 75
Demus, Jakob
Nachtschau, S. 78
Stárková, Magdaléna
Die Nacht verteilt. Gedichte, S. 87
Wegmann, Christoph
Der Kanzler und die Sängerin. Aus Theodor Fontanes »Musée imaginaire«, S. 90
Theodor Fontane besaß nicht besonders viele Bilder, sein Kopf aber war voll davon. Voller Fresken, Graffiti, Denkmäler, Zeitungsillustrationen, (...)
Nolte, Paul
Handschrift und Helfer. Thomas Nipperdeys »Deutsche Geschichte«, S. 98
Thill, Hans
Schafwinter. Gedichte, S. 112
Kleinschmidt, Sebastian
Vom Unheil des Erkennens. Hartmut Langes erster Novellenband, S. 115
Rothmann, Ralf
Dunkler Umriß – Kleist und das Glück. Dankrede zum Kleist-Preis 2017, S. 125
Heinemann, Elke
Under Cover. James Kirkups Erzählung über Heinrich von Kleist und Thomas Pynchon, S. 128
Ansull, Oskar
Aspekt einer schwierigen Identitätsfindung. Karl Emil Franzos, Walter Benjamin, Ludwig Strauß, Paul Celan, S. 134
Krieger, Hans
»Zieh den Mondkork aus der Nacht!« Noch einmal Christine Lavant: ein Nachtrag zu Werk und Rang, S. 136