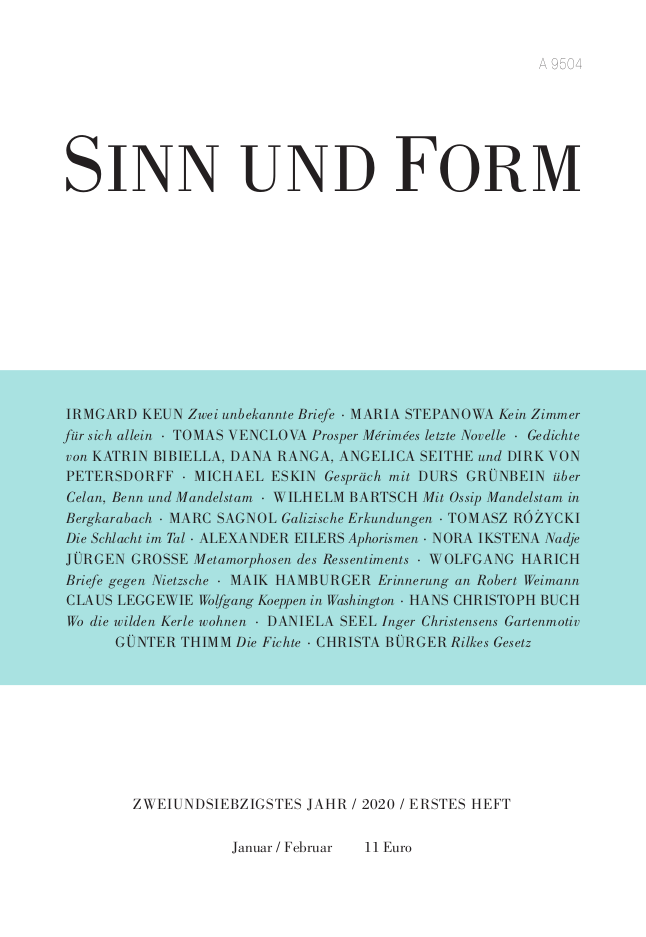
[€ 11.00] ISBN 978-3-943297-51-5
Printausgabe bestellen[€ 8,00]
PDF-Ausgabe kaufenPDF-Download für Abonnenten Sie haben noch kein digitales Abo abgeschlossen?
Mit einem digitalen Abo erhalten Sie Zugriff auf das PDF-Download-Archiv aller Ausgaben von 2019 bis heute.
Digital-Abo • 45 €/Jahr
Mit einem gültigen Print-Abo:
Digital-Zusatzabo • 10 €/Jahr
Heft 1/2020 enthält:
Keun, Irmgard
»Ich sehne mich zwar nach Ruhe, aber ich ertrage sie nicht«. Zwei unbekannte Briefe an eine Freundin. Mit einer Vorbemerkung von Matthias Meitzel, S. 5
Vorbemerkung »Ist Münzenberg tot? Was ist mit Irmgard Keun?« Als sich Nelly und Heinrich Mann am 11. Januar 1941 besorgt bei Hermann Kesten nach (...)
Bibiella, Katrin
Lux Aeterna. Gedichte, S. 13
Stepanowa, Maria
Kein Zimmer für sich allein, S. 15
Ich bin keine Wissenschaftlerin und kann mir daher die Freiheit nehmen, mich als Schriftstellerin, ja als Dichterin zu betrachten. Letzteres ist (...)
Venclova, Tomas
Prosper Mérimées letzte Novelle, S. 25
Ranga, Dana
Cosmos II. Gedichte, S. 36
Eskin, Michael
Die Facetten der Scham. Ein Gespräch mit Durs Grünbein über Celan, Benn und Mandelstam, S. 40
Bartsch, Wilhelm
Schuscha, die Raubmordstätte. Mit Ossip Mandelstam in Bergkarabach, S. 49
Sagnol, Marc
Galizische Erkundungen. Sambor, Stryj, Bolechów, S. 58
SAMBOR Am Fuße der Karpaten, an der Straße, die hinauf zu den Almen der Polonina führt, liegt die Stadt Sambor anmutig über dem Dnjestr, der (...)
Seithe, Angelica
Lichtung. Gedichte, S. 69
Różycki, Tomasz
Die Schlacht im Tal. Aus einem Versepos, S. 71
Eilers, Alexander
Kiesel. Aphorismen, S. 80
Horch! Da braust das Malmen
Der Kiesel, die Wellen zurücksaugen, und
–Wiedergekehrt – an den hohen Strand schleudern,
Das (...)
Petersdorff, Dirk von
An eine Dreizehnjährige. Gedicht, S. 81
Ikstena, Nora
Nadje, S. 83
Große, Jürgen
Metamorphosen des Ressentiments, S. 91
Harich, Wolfgang
»Die reaktionärste, menschenfeindlichste Erscheinung der Weltkultur«. Vier Briefe über Nietzsche an Stephan Hermlin. Mit einer Vorbemerkung von Andreas Heyer, S. 103
Hamburger, Maik
Der weite Weg zu den Bermuden. Erinnerung an Robert Weimann, S. 121
Leggewie, Claus
Auf den Spuren Wolfgang Koeppens in Washington, S. 123
»Die Kasernen der geimpften Kreuzritter auf Europas Boden, der erneuerte Limes am Rhein, Raketenrampen im schwarzen Revier, Versorgungsbasen bei der (...)
Buch, Hans Christoph
Wo die wilden Kerle wohnen. Laudatio auf Berthold Zilly, S. 127
Seel, Daniela
Der Garten, in dem man verschwindet. Zum Gartenmotiv in Inger Christensens »Alphabet«, S. 131
Thimm, Günter
Stehst bald nicht mehr da, o Fichte, S. 133
Bürger, Christa
Rilkes Gesetz, S. 135
