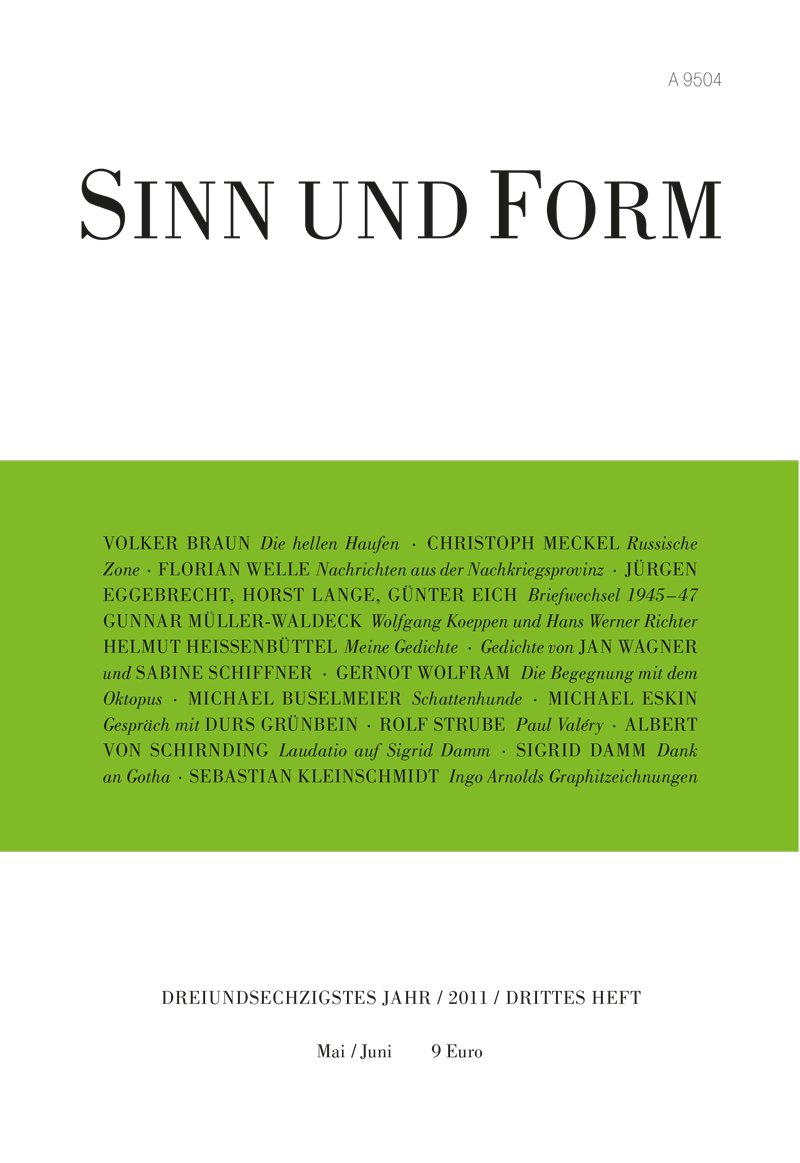Leseprobe aus Heft 3/2011
Eskin, Michael
Tauchen mit Descartes
Gespräch mit Durs Grünbein
MICHAEL ESKIN: Sie haben einmal gesagt, »Der cartesische Taucher« sei Ihr vielleicht wichtigstes Buch. Könnten Sie das näher erläutern?
DURS GRÜNBEIN: Dieses Buch ist im Grunde ein ,Kommentar’ – zu dem Buch, das mir am meisten am Herzen liegt, dem Erzählpoem »Vom Schnee oder Descartes in Deutschland«. Mit ihm habe ich mich als Dichter am weitesten vorgewagt, den größten Abstand zu unserer Gegenwart gewonnen und sie so, aus der barocken Vogelperspektive, zum ersten Mal deutlich gesehen: als die gewaltige Neuzeit, die sie ist. Das ist der Sinn meiner cartesischen Expedition. Ich habe mich wie Selma Lagerlöfs Nils Holgersson – mein liebstes Kinderbuch – auf die Reise gemacht, um das Gelände kennenzulernen, in dem wir technisierten Wesen uns heute bewegen. Nur mußte ich dazu eine Zeitreise antreten, mußte zurückfliegen in die Epoche des Dreißigjährigen Krieges, der Glaubenskämpfe und wissenschaftlichen Revolutionen in einem Europa, das daran ging, mit allem Tabula rasa zu machen. Die kopernikanische Wende war eben eingetreten, die Teleskope rückten den Mond und die Planeten in vertraute Nähe, die Mikroskope begannen das Körperinnere zu erkunden. In dieser Zeit zerbricht das Reale in zwei Teile: hier die ausgedehnte Substanz – die Materie, der Kosmos, die vieltausendfachen Erscheinungen des Seins –, und dort die erkennende Substanz – der Geist, das Bewußtsein, das sich mit allen technischen Mitteln hineinfräst in die Natur und sie so endgültig verwandelt und zivilisiert. Ich wollte das Abenteuer des berühmten Cogito oder Erkenntnis-Ichs im Moment seines Beginnens, am Ort seiner Entstehung sehen. Es geht um die Geburt des Rationalismus aus dem Geist des Winters, um Descartes’ Visionen am Rande der sogenannten Kleinen Eiszeit, die damals Europa heimsuchte. Davon handelt mein Poem, und von den Hintergründen desselben handelt »Der cartesische Taucher«. Beide Bücher gehören zusammen, sie sind die zwei Seiten einer Medaille.
ESKIN: Ihr poetisch-philosophisches Meditationsbuch, das im Dialog mit den »Meditationen« von Descartes und den »Cartesischen Meditationen« Edmund Husserls steht, scheint mir aber doch auch ein ganz eigenständiges Werk zu sein. Sie schreiben, der »Discours de la méthode« sei ein »verwegener Coup« gewesen, der sich, »im Grunde kaum mehr als ein Vorwort, bestimmt für ein fachfremdes Publikum«, als »folgenreichster Bildungsroman der Neuzeit« entpuppte. Ist »Der cartesische Taucher« nicht ein ebensolches Manifest, wenn auch unter ganz anderen Vorzeichen?
GRÜNBEIN: Die Zeit der Manifeste ist vorbei. Unsere poetischen Rechenschaftsberichte sind heute sehr viel bescheidener, aber dafür auch spezifischer. Ich habe in einer Poetikvorlesung gesagt: »Ungeliebt wie der Kriegsdienst und die Ämterbürokratie ist das Diktat der Künstler und Literaten in eigener Sache«. Ein Dichter kann heute nur aus seiner begrenzten Perspektive heraus nachdenken. Deshalb bevorzuge ich den Ausdruck Meditation, er hat etwas von Klausur und Vergewisserung, er betont das Moment der Einkehr bei sich selbst. Wir meditieren, um uns über etwas klar zu werden, das ist eine Expedition mit offenem Ausgang, kein Schaulaufen mit festen Begriffen. So weiß ich zum Beispiel noch immer nicht, wie Gedichte eigentlich funktionieren. Ich ahne etwas von gebündelter Wortenergie und davon, daß gute Poesie etwas in uns aufwühlt, was dort lange geschlummert hat und nur geweckt werden mußte. Aber wie dieser Weckdienst für die versiegelten Emotionen und Erlebnisse im einzelnen abläuft, warum gewisse Verse etwas in unserer Psyche auslösen, andere nicht – das ist eine Frage, bei der ein Barockphilosoph genauso mitreden kann wie ein Literaturwissenschaftler von heute. Was weiß denn die Gehirnforschung über die Funktionsweise von Metaphern? Wie kommt es, daß uns Gedichtzeilen ein Leben lang verfolgen? Das sind alles Fragestellungen, denen eine künftige Physiopoetik nachgehen könnte. Ich habe nur ein paar Gedanken weitergesponnen, die sich bei meiner alexandrinischen Schlittentour mit dem Philosophen Descartes ergeben haben.
ESKIN: Am Ende Ihrer Meditationen schreiben Sie: »Um Poesie zu betreiben, aber mehr noch, um sie recht zu verstehen, das heißt, ihr in aller Innigkeit und auf gleicher Höhe mit ihren Geistesblitzen zu begegnen, braucht es ein gut gefügtes Gehirn.” Was meinen Sie damit?
GRÜNBEIN: Das klingt sehr provokativ, nicht wahr. Wenn man den Anfang des Büchleins aufschlägt, stößt man auf das Briefzitat von Descartes, wo er vom gut gefügten Gehirn spricht ("un cerveau bien rassis«). Ehrlich gesagt, war es diese Formulierung, die mich am meisten überrascht hat und die zum Auslöser wurde für alles. Monatelang ist mir diese Wendung im Kopf herumgespukt, dann habe ich mich hingesetzt und die Meditationen geschrieben. Ich interpretiere die Stelle im Licht der cartesischen Seelentheorie, die eine Weiterentwicklung antiker Temperamentenlehren ist, medizinische Erkenntnisse der Barockzeit berücksichtigt und so zum Vorläufer der Psychophysik im neunzehnten und zwanzigsten Jahrhundert wurde. Soviel ich weiß, haben wir keine Psychoanalyse, die an Strukturen der Dichtung anknüpfen würde. Ich bin also gezwungen, mich bei älteren Schriftstellern umzusehen. Das gut gefügte Gehirn, wie Descartes es versteht, ist eines, das mit Erschütterungen durch das Erhabene umzugehen weiß. Es hält die sprachlichen Sensationen aus, so wie ein echter Cineast noch die aufwühlendsten Bilder auf der Kinoleinwand verarbeiten kann. Das hat nichts mit Abstumpfung zu tun, sondern im Gegenteil mit ästhetischer Erziehung. Aber ein gewisser Anteil von seelischer Begabung gehört auch dazu. Es gibt auch im Leser ein Talent und eine Charakterstärke, die vonnöten sind, um Poesie auszuloten und zu ertragen. Zu Descartes’ Zeiten waren es eben Verse, die die Seele in einen Taumel versetzen konnten, es war Lektüre, die aufputschte, das barocke oder antike Drama mit seinen heißen Stellen. Heute braucht es ein gut gefügtes Gehirn, um der schrecklichen Medien- und Kinobilder Herr zu werden und nicht in Depressionen zu versinken angesichts des täglichen Beschusses mit Photographie und Television, dieser Pornographie des Realen.
ESKIN: Wie müßte eine Lektüre aussehen, um sich als ein solches Mit-Meditieren zu entfalten?
GRÜNBEIN: Als Leser streiche ich mir gern Stellen an, die ich mit anderen Stellen in anderen Büchern verknüpfen kann. So entsteht ein Gewebe aus Textpassagen, die zueinander passen, einander ergänzen und erweitern. Ein solches Vorgehen seitens des Lesers habe ich mir immer auch für meine Schriften gewünscht. Ich sehe mich als Teil eines Kontinuums zentraler Gedanken, an denen Kunst und Philosophie sich seit langem abarbeiten. Mein einziges Mitspracherecht ist die Poesie. Auf sie muß ich mich verlassen können, und vice versa. Sie verlangt nach der Überraschung, sie sucht das geistige Abenteuer, die Verblüffung, darf alle ihr zur Verfügung stehenden Ausdruckstechniken anwenden. Die Poesie gestattet es einem, Sprünge zu machen, sich als Känguruh durch die Landschaften der Imagination zu bewegen. Die philosophische Meditation zu Zeiten Descartes hatte dagegen eine klare Funktion, sie kam aus einer langen theologischen Tradition und konnte sich auch auf die christliche meditatio der Mönche berufen. Sie war ein strenger Disput mit sich selbst, der Versuch, den eigenen Thesen die Form einer öffentlichen Beichte zu geben. Und die Geister der Zeit waren eingeladen, Widerspruch anzumelden, Ergänzungen, Einwände anzubringen, darauf wurde dann wieder geantwortet, bis das Argument rundum verteidigt war. Dichtung muß nicht argumentativ überzeugen, sie sollte anregen und verführen. Die Bezeichnung Meditation weist aber darauf hin, daß auch der Dichter am erkenntniskritischen Gespräch teilnehmen möchte. Die Reflexion der Vorstellungskraft ist ein Thema, bei dem wir aufeinander zugehen müssen. Es betrifft die Art, wie wir Erkenntnisse vermitteln, und ist damit universell und nicht-exklusiv.
ESKIN: Wie denken Sie über das Potential des »Cartesischen Tauchers« im englischsprachigen Raum? Glauben Sie, daß Descartes im kulturellen Bewußtsein der USA eine besondere Stellung einnimmt?
GRÜNBEIN: In Sachen Descartes geschieht fast alles in den Vereinigten Staaten. Mir scheint, die Liste der Neupublikationen dort übertrifft selbst sein Geburtsland Frankreich. Viel Polemik kommt von Seiten der Neurowissenschaften. Man denke nur an Damasios Bestseller »Descartes’ Irrtum«. Leider kennen die Naturwissenschaftler und Mediziner ihren Descartes nur sehr oberflächlich. Er ist für sie so etwas wie eine Vogelscheuche auf dem weiten Feld der Philosophiegeschichte. Weit sachlicher ist die Auseinandersetzung unter den Schulphilosophen. Für einen Meister wie Stanley Cavell wird Descartes zum Kronzeugen der Abrechnung mit gewissen Auswüchsen der Analytical Philosophy. Für Lacan ist er geradezu der Gegenpol zu Sigmund Freud in seiner Subjektkonstruktion. Die cartesische Position ist unverzichtbar, will man den leeren Ort fassen, von dem aus das moderne Subjekt jenseits aller Einzelpsychen operiert. Nur so läßt sich die Katastrophe der Verantwortungslosigkeit in den Naturwissenschaften begreifen. Bemerkenswert ist die Betonung des dynamischen Wandels im cartesischen Denken, den man erst heute deutlicher sieht, so etwa in Machamer und McGuires jüngst erschienener schöner Studie »Descartes’s Changing Mind«, die das lebendige Interesse an unserem Helden bezeugt. Darüber hinaus ist er zum Darling der Biographiesektion geworden. Wir müssen uns klarmachen, daß Descartes für das Verständnis des neuzeitlichen Bewußtseins und der Entwicklung der westlichen Philosophie mindestens so bedeutend ist wie Sigmund Freud für das zwanzigste Jahrhundert. Er ist eine der großen geistigen Gründerfiguren der Neuzeit, ein Pionier, der in Grenzbereiche vorstieß, und als solcher dürfte er auch für amerikanische Leser von Interesse sein. Vergessen wir nicht, daß wir es hier mit einem geistigen Unternehmer zu tun haben, er war der Metaphysiker als Selfmademan. Descartes war gewissermaßen eine reisende Universität, einer, der in ganz Europa unterwegs war (die meiste Zeit in Holland) und doch per Korrespondenz vernetzt blieb mit den wichtigsten Gelehrten seiner Zeit. In dieser Hinsicht haben ihm Philosophen wie Leibniz oder Pascal, seine ersten großen Kritiker, nachgeeifert. Diesem Chevalier mit seinen lebenslangen Streifzügen durch die kühle, erregende Welt des reinen Denkens und der Vivisektion ist der größere Teil der Menschheit seither gefolgt, bewußt oder unbewußt. In einem meiner frühen Gedichte sah ich den Poeten einmal in der Gestalt eines cartesischen Hundes.
ESKIN: Was Sie eben ausgeführt haben, erklärt vielleicht, warum Descartes in den USA so populär ist, wo er doch als Europäer par excellence der Alten Welt viel näherstehen sollte.
GRÜNBEIN: Descartes ist so populär, weil er den Glücksrittern Amerikas eine schmeichelhafte Vorstellung davon verschafft, wie man sein Ich maximal vergrößert. Da ist die Welt: nimm sie dir! Die Instrumente dafür liegen bereit, dein gestähltes Erkenntnis-Ich durchbricht alle Grenzen. Yes, you can …
[...]
SINN UND FORM 3/2011, S. 389-402