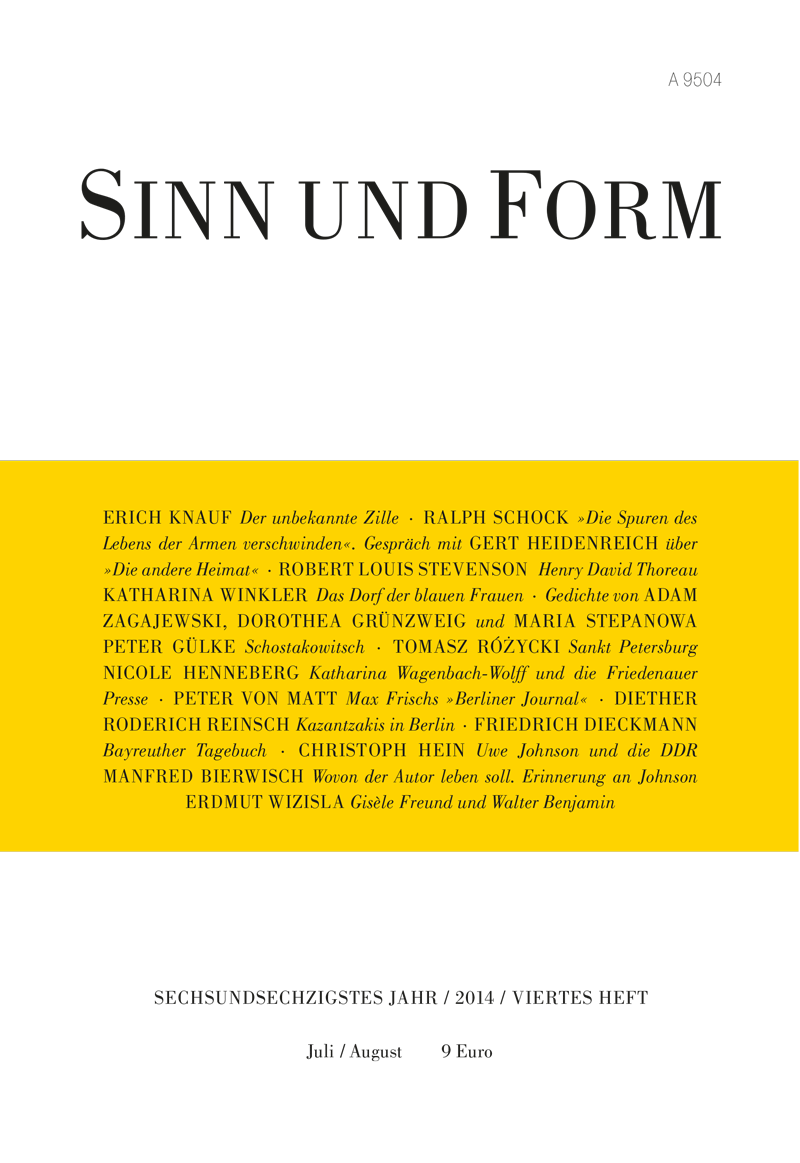Leseprobe aus Heft 4/2014
Schock, Ralph
»DIE SPUREN DES LEBENS DER ARMEN VERSCHWINDEN»
Ein Gespräch mit Gert Heidenreich über »Die andere Heimat»
RALPH SCHOCK: Ihre Erzählung »Die andere Heimat« hat eine Menge mit dem gleichnamigen Film von Edgar Reitz und Ihnen zu tun, denn Sie sind auch der Koautor des Drehbuchs. Wie kam es zu dieser Kooperation?
GERT HEIDENREICH: Edgar Reitz hatte seit vielen Jahren die Idee, sich mit der Auswanderung aus dem Hunsrück in der Mitte des 19. Jahrhunderts, vorwiegend nach Brasilien, zu beschäftigen. Zum einen, weil auch Vorfahren von ihm ausgewandert waren, deren Nachkommen noch in Südamerika leben, zum anderen, weil sich Edgars verstorbener jüngerer Bruder Guido als eine Art linguistischer Privatgelehrter mit indigenen Sprachen beschäftigt hat. 2009 fragte Edgar Reitz mich, ob ich mir vorstellen könnte, mit ihm einen solchen Film zu erarbeiten und gemeinsam das Drehbuch zu schreiben. Wir kannten uns zwar schon ein bißchen, hatten aber noch nie etwas zusammen gemacht. Ich hatte noch nie ein Spielfilm-Drehbuch geschrieben, bloß einige Theaterstücke fürs Fernsehen bearbeitet, aber das ist ja etwas ganz anderes. Und er hatte wohl aufgrund meiner Romane, von denen er einige gelesen hatte, den Eindruck, mit mir könnte es gehen. Er braucht für die Fiktionalisierung eines Stoffs, eines Materials immer einen Partner, im Gespräch entwickelt er die besten Ideen. So kam es dazu, daß er mich fragte, und ich sagte erst einmal: »Ich habe keine Ahnung, ob ich das kann.« Aber ich wolle mir gern von ihm sagen lassen, wie er sich das denke, was er schon geplant und vorbereitet habe, und dann sind wir ein paar Tage im Hunsrück spazierengegangen. Während er dabei erzählte, was für Geschichten er sich ausgedacht hatte, merkte ich, daß auch bei mir sofort Bilder und Ideen für eine Handlung entstanden. Das ging dann so hin und her. Es war sehr merkwürdig, eine Art gemeinsames Phantasieren. Danach haben wir beide gesagt: Ja, wir versuchen es.
SCHOCK: Was stand zu Beginn der Zusammenarbeit fest? Was war vorgegeben? Der Schauplatz offenbar, der Hunsrück. Kannten Sie den? Edgar Reitz sagt, durch die Region sei es für ihn ein persönlicher Stoff. War er das auch für Sie?
HEIDENREICH: Er ist dort geboren, von dort geflohen und wieder dorthin zurückgekehrt. Für mich war das eine fremde Gegend. Ich bin zwar ab und zu durch den Hunsrück gefahren, aber mit seiner Geschichte, mit den Menschen, habe ich mich eigentlich nur mittels der Filme von Edgar Reitz beschäftigt, vor allen Dingen »Heimat 1« und »Heimat 3«. Die kannte ich sehr gut. In »Heimat 2« hat mein Stiefsohn Michael Seyfried eine größere Rolle gespielt. Diese Zyklen haben mich vor allem filmisch interessiert, weil der Autorenfilmer Reitz einen ungemein genauen psychologischen Zugriff auf die Figuren hat, und das fasziniert einen als Romancier. Vieles von dem, was er über den Hunsrück Mitte des 19. Jahrhunderts recherchiert hatte, mußte er mir erst mal vermitteln. Als wir anfingen, gab es ein Treatment, in dem schon die beiden Brüder vorkamen – ein Bodenständiger und ein Träumer, der unbedingt auswandern will und sich schon fast als Indianer fühlt –, aber es gab im Grunde noch keine Handlung. Dann haben wir uns erst einmal an die Recherchen gemacht – eine große Schwierigkeit, wenn es um arme Menschen geht. Der Reichtum bleibt, die Paläste des Adels stehen noch; es gibt eine Fülle von Dokumenten, ganze Adelsregister, mitunter sogar Biographien, so daß man sich das Leben der Reichen relativ leicht erschließen kann. Es ist auch leicht, Reichtum im Film zu zeigen: Sie brauchen nur ein Schloß, ein paar Kerzenständer, ein schönes Buffet, ein paar Kostüme und Musik, und schon haben Sie einen Ball. Die Spuren des Lebens der Armen verschwinden, ihre Welt muß von Grund auf rekonstruiert werden. Deshalb ist es teuer, Armut zu drehen, und billig, Reichtum zu drehen. Auch beim Recherchieren ist der Aufwand viel größer. Das war uns von Anfang an klar, aber wir haben großes Glück gehabt.
SCHOCK: In welcher Hinsicht?
HEIDENREICH: Um das zu erklären, muß ich kurz auf die historische Situation eingehen: Die angrenzende Pfalz, wo die Lebensumstände ganz ähnlich waren, kam nach dem Ende der napoleonischen Besetzung zu Bayern, während der Hunsrück preußisch wurde. Aber die Preußen kümmerten sich so gut wie gar nicht um die Gegend. Sie machten allerlei Auflagen und verhängten drakonische Strafen für den sogenannten Waldfrevel, also wenn die armen Leute Holz holten, aber kümmerten sich nicht um ihr Leben und ihre Lage. Der bayrische König Max dagegen wollte, aus welchen Gründen auch immer, genau wissen, wie es seinen Untertanen in der Pfalz ging, und stellte zu diesem Zweck sogenannte Kantonsärzte ein. Das waren Beamte des Münchner Hofs, die in verschiedenen Regionen oder Kantonen der Pfalz lebten und jedes Jahr einen umfangreichen Fragenkatalog durcharbeiten mußten. Über fast alles wurde Buch geführt, nicht nur über Geburten und Todesfälle, sondern auch darüber, wie die Menschen lebten, wie ihre Betten aussahen, wie viele Personen darin schliefen, welche Rolle Sexualität vor und in der Ehe spielte, wie es um die Wasserversorgung, um Heilkräuter und den Aberglauben bestellt war. All diese Informationen waren jährlich abzuliefern, wofür die Ärzte umfängliche Recherchen auf sich nehmen mußten. Für sie war das schlimmer als für uns heutzutage die Steuererklärung, doch für uns ist es ein Glück, denn ihre Berichte sind erhalten. Sie liegen im Landesarchiv in Ludwigshafen und sind wegen ihrer kalligraphischen Schrift gut lesbar. Hoch lebe König Max, der es uns ermöglicht hat, diese Verhältnisse, die man im wesentlichen auf den Hunsrück übertragen kann, so genau zu studieren! Das war wirklich eine große Erleichterung.
SCHOCK: Wurden diese Berichte von der Geschichtsforschung bisher gar nicht aufgearbeitet?
HEIDENREICH: Das schon, es sind ja auch zwei oder drei Bände transkribiert und mit Anmerkungen versehen worden, und man weiß sogar, wo die Kantonsärzte geschwindelt oder es sich leichtgemacht haben. Aber wir wollten die Quellen selbst konsultieren und haben, gerade im Hinblick auf Alltagssituationen oder den Aberglauben, auch sehr davon profitiert. Dann kam irgendwann der Punkt, an dem wir die Figuren gestalten mußten, Edgar Reitz nennt das die Fiktionalisierung des Materials. Da sagte er den für mich überraschenden Satz: »Denk jetzt mal nicht ans Drehbuch, sondern tu das, was du kannst, schreib eine Erzählung.«
SCHOCK: Wann war das ungefähr? Wie lange hatten Sie sich schon darüber unterhalten?
HEIDENREICH: Das war nach sechs, sieben Wochen Arbeit. In dieser Zeit haben wir natürlich auch schon über die Figuren phantasiert. Wie das beim Schreiben so geht, ergaben sich in der Erzählung neue Konstellationen zwischen den Figuren und den Geschichten. Bevor ich anfing, habe ich vor allen Dingen Namensrecherchen betrieben. In der Prosa wie auch im Film ist es ja ungeheuer wichtig, daß die Namen zu den Figuren passen. Heutzutage gibt es im Internet die wunderbare Möglichkeit, die Häufigkeit von Vor- und Nachnamen in einer Region zu einer bestimmten Zeit festzustellen. So konnte ich Namen finden, die damals im Hunsrück gebräuchlich waren, und brauchte nur ein bißchen Intuition, um die Vor- und Nachnamen zu verkoppeln. Auf diese Weise entsteht schon etwas von dem, was wir Authentizität nennen. Wenn eine Figur einen Namen trägt, bekommt sie ein Gesicht und wenig später auch ein Schicksal. Damit habe ich begonnen und dann in drei Monaten die ganze Erzählung geschrieben – es sind bloß 130 Seiten –, und das war der Stand der Dinge, als wir mit dem Drehbuch begannen. Edgar Reitz sagte zu Recht: »Jetzt sind wir im Bereich der Fiktion, jetzt müssen wir noch einmal bei Null anfangen, denn das Drehbuch zu schreiben ist etwas völlig anderes, als die Erzählung zu schreiben.« Ich kann auch gerne darlegen, warum das so ist: Ich schreibe meine Romane und Erzählungen so, wie es meist bei zeitgenössischer Prosa der Fall ist, nämlich mit Vor- und Rückblenden, Assoziationen und Erinnerungen. Meine Erzählung »Die andere Heimat« ist im Prinzip eine komplette Rückblende, ausgehend vom Tag des Abschieds der Auswanderer, der vom Vormittag bis zum Nachmittag geschildert wird. In dieser Spanne sind sämtliche Erinnerungen, Erlebnisse und Wandlungen der Figuren enthalten. Das wollte Edgar Reitz auf keinen Fall. Er wollte keine Rückblenden. Ich habe das zuerst nicht verstanden, weil es das ja auch im Film gibt – ich habe dreizehn Jahre als Filmkritiker gearbeitet und kenne mich ganz gut aus. Aber er meinte, Rückblenden seien ein intellektuelles Stilmittel, und wir hätten es hier mit einem archaischen Stoff zu tun, mit armen Menschen, die ums Überleben kämpfen. Archaische Geschichten werden, wie man an den großen Epen der Menschheit sehen kann, immer linear erzählt. Deswegen wollte er, daß auch der Film linear erzählt. In dieser Hinsicht war die Erzählung unverfilmbar. Wir brauchten also einen Punkt, wo die Geschichte beginnen konnte, und es war klar, daß die Hauptfigur Jacob, der Träumer, schon in der ersten Szene in einer typischen Situation auftreten mußte. Deshalb beginnt der Film damit, daß der Vater, ein Feind des Lesens, erst das Buch und dann den Sohn hinausschmeißt.
[…]
SINN UND FORM, 4/2014 S. 470-479, hier S. 470-473