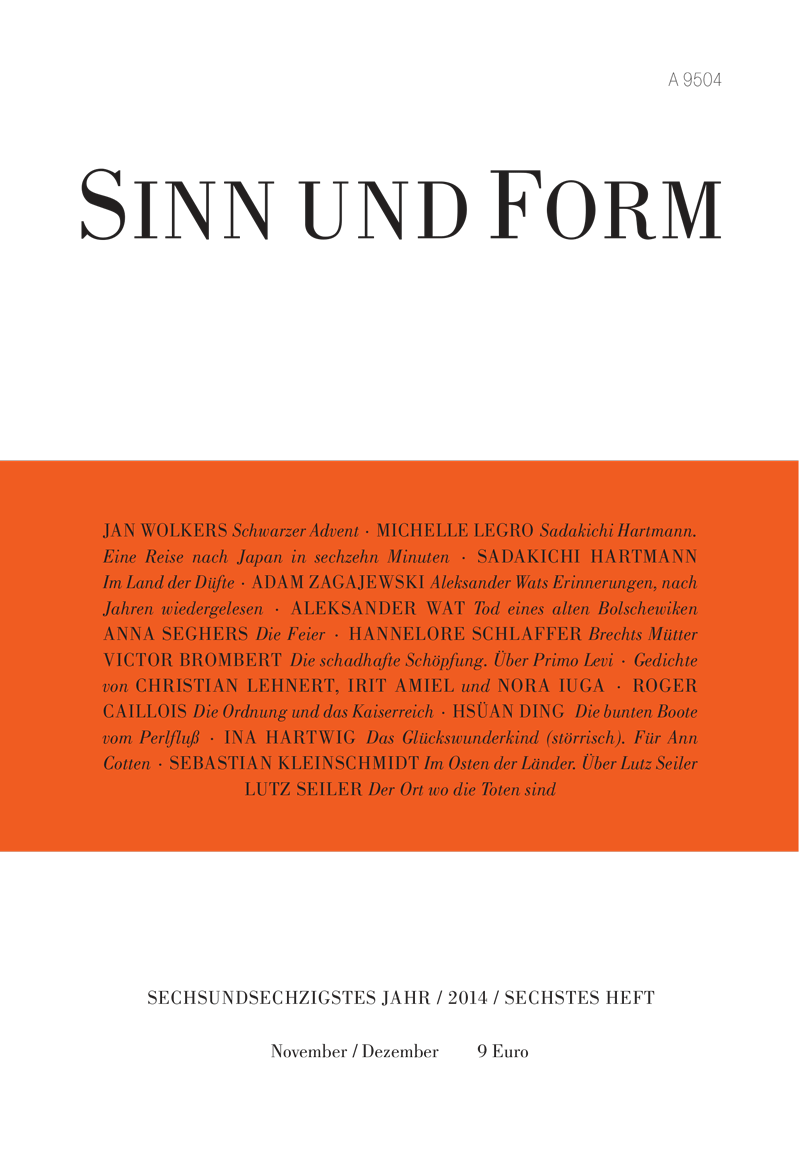Leseprobe aus Heft 6/2014
Zagajewski, Adam
Aleksander Wats Erinnerungen, nach Jahren wiedergelesen
Die erste Ausgabe von »Mój Wiek« (Mein Jahrhundert) erschien 1977 in London, genau zehn Jahre nach dem Tod des Autors (die deutsche Fassung aus dem Jahr 2000 trägt den Titel »Jenseits von Wahrheit und Lüge. Mein Jahrhundert. Gesprochene Erinnerungen 1926–1945«). Wats Freunde im Exil waren sicher verärgert, weil sich die Veröffentlichung so lange hinzog, aber für die Leser in Polen war es ein besonderer, gleichsam sorgfältig gewählter Moment – im Land entstand gerade die Massenopposition, die damals noch elitär, das heißt auf Bildung ausgerichtet und dem Lesen zugeneigt war. Die Bewegung brachte Hunderte, wenn nicht Tausende Leser hervor, die sehnsüchtig auf ein neues ernsthaftes Wort zur dunklen Geschichte des zwanzigsten Jahrhunderts warteten. Wats Buch war eine Sensation; zugänglich nur in einer kleinen Anzahl von Exemplaren (bis es im Samisdat in weniger eleganter, aber zugänglicherer Form erschien), wurde es von Hand zu Hand weitergereicht, nachts verschlungen, eilig und in angespannter Konzentration; in unterschiedlichen Städten bildeten sich Schlangen von Menschen, die auf das Buch warteten und darüber diskutierten … Neben den Erinnerungen Nadeschda Mandelstams, die mit »Jahrhundert der Wölfe« gleichsam den Tod Ossip Mandelstams rächen wollte, neben Alexander Solschenizyns »Archipel Gulag« und Gustaw Herling-Grudzińskis »Welt ohne Erbarmen« war Wats Buch unverzichtbar für jeden, der Aufklärung suchte, der sich von den sowjetischen Lügen befreien wollte. In Polen formierte sich die Oppositionsbewegung, doch die Sowjetunion war unter der Führung des senilen und verblödeten Leonid Breschnew, der sich in seinen letzten Regierungsjahren wie eine große, unbeholfene und mit buschigen Augenbrauen geschmückte Puppe bewegte, noch immer der Schrecken der westlichen Welt (und die Hoffnung der unverbesserlichen und unbelesenen Kommunisten Lateinamerikas).
So viele Jahre später kann man durchaus fragen, ob das Buch dem Fluß der Zeit standgehalten hat – ob es, wie ein großer Teil der umfangreichen Literatur über die Sowjetunion, in den hinteren Regalen unter einer barmherzigen Schicht von Staub verschwunden oder als ein den üblichen Rahmen professioneller politologischer Abhandlungen sprengendes Werk lebendig geblieben ist. Die Antwort ist leicht: Ja, das Buch lebt, es atmet, es hat den Zeitenwandel, den Untergang des Kommunismus, das Aufkommen neuer Bedrohungen und Paradigmen bestens überstanden. Dafür spricht sein internationaler Erfolg: Es ist für zahlreiche Leser zum Standardwerk geworden, und sein Autor gilt als einer der wichtigsten Augenzeugen und Chronisten des schrecklichen zwanzigsten Jahrhunderts. Mit der Zeit – dieser Prozeß wird sich wohl in Zukunft fortsetzen – ändert sich freilich die Rezeptionsperspektive: Man liest »Mein Jahrhundert« immer weniger als unmittelbares, erschütterndes Zeugnis der Tragödie des Stalinismus oder der idealistischen, reinen (und naiven) Kommunisten, sondern zunehmend als außergewöhnlichen poetisch-philosophischen Traktat, als einzigartiges romantisch-ironisches Epos, in dem das Thema natürlich nicht an Bedeutung verliert, aber der Akzent sich langsam von »Jahrhundert« auf »mein« verschiebt, von Stalin auf Wat, von der Beschreibung sowjetischer Gefängnisse auf die intellektuelle Entwicklung des Autors. Die ersten Leser mögen vor allem die Informationen über das sowjetische System aufgesogen haben, die Beschreibung des Gulags aus der Innenperspektive, spätere Leser dagegen lauschen wohl eher Wats individueller Stimme, sie bewundern seine brillante Intelligenz, seine Beobachtungsgabe – vielleicht mögen sie sogar seine Manierismen, seine Erinnerungsticks, die exzentrischen gelehrten Exkurse und die Eigenheiten seines Denkens und Sprechens. Und wenn ich mich nicht irre, tut Wats Buch diese Akzentverschiebung gut – vom »Dokument« zum Epos, vom Zeugnis zur Literatur.
Ich habe es kurz nach seinem Erscheinen gelesen. Es machte einen ungeheueren Eindruck auf mich. Es schien mir geradezu, als sei es für mich, für Leute wie mich geschrieben worden. In der zweiten Hälfte der siebziger Jahre gehörte ich zu den neuen Lesern, die Informationen über die jüngste Geschichte suchten, aber ich war zugleich ein junger Dichter, der gegen den Kommunismus, gegen das totalitäre Herrschaftssystem rebellierte und seine Revolte in Gedichten ausdrücken wollte. Ich rebellierte, fragte mich aber gleichzeitig, wie man gegen den Totalitarismus kämpfen konnte, wenn man kein Gesellschaftsaktivist war, keine politischen Ambitionen hatte, wenn man Dichtung, Musik und die Momente seliger Einsamkeit weit mehr liebte als Parteiversammlungen, selbst wenn es sich um eine Gruppierung edler Oppositioneller handelte. (Obwohl ich gestehen muß, daß einige Treffen der Fliegenden Universität, bei denen Schriftsteller und Professoren zusammenkamen, darunter Wisława Szymborska, Kornel Filipowicz, Jan Józef Szczepański und Jacek Woźniakowski, überaus interessant waren …) Ich schrieb offen politische, kritische Gedichte, aber ich spürte, das war nicht der eigentlich künstlerische Weg, die Poesie war anderswo, in Bereichen höherer Komplexität, in der Fähigkeit, die Vielheit der Welt anders als durch die moralische Verurteilung des ideologischen Gegners zu erfassen. Ähnliche Gedanken finden sich in Zbigniew Herberts schönem Gedicht »An Ryszard Krynicki – Ein Brief«:
auf die mageren schultern luden wir uns die sache der öffentlichkeit
den kampf mit der tyrannei der lüge leidensberichte
doch unsere gegner – gib’s zu – waren erbärmlich klein
lohnte es sich die heilige sprache zum lallen zu mindern
von der tribüne herab zum schwarzen abschaum der presse
Wat half mir, Antworten auf diese Fragen zu finden; er diktierte ja Czesław Miłosz sein Buch aus der Position eines nicht mehr jungen, von Krankheit geplagten Menschen – dabei läßt das Buch weder Müdigkeit noch Krankheit erkennen, es ist vielmehr ein Fest der Konversation, bisweilen spürt man darin die Freude am Denken –, vor allem aber aus einer Position der Weisheit, die er den Erfahrungen und Irrtümern seines schweren und intensiven Lebens verdankte. Wenn er etwa von der Notwendigkeit sprach, »sich vom Gegner loszureißen«, wenn er sagte, die intellektuelle oder künstlerische Auseinandersetzung mit dem Totalitarismus müsse Distanz wahren, sie dürfe nicht zum Aufbegehren, zur unmittelbaren Konfrontation, zur »Auseinandersetzung mit dem Kommunismus« werden, sondern müsse auf das »Leben und Sein auf einer völlig anderen geistigen Ebene« abzielen, auf tiefe, die rein politischen Emotionen transzendierende Erlebnisse, so war das etwas Großartiges, etwas Wunderbares, das meinen – und sicher nicht nur meinen – künstlerischen Weg entscheidend beeinflußte, vielleicht nicht sofort, nicht von einer Woche auf die andere, aber bestimmt in den folgenden Jahren.
Absolut vital ist auch, was Wat, der als junger Mann der absurden Ästhetik des Dadaismus frönte und den kurz der Futurismus in seinen Bann schlug, über jene Einsicht sagt, die in sowjetischer Haft für ihn zum Wendepunkt wurde: Daß man die Sprache nicht aus frivolen ästhetischen Motiven deformieren darf, sondern sie achten und verteidigen muß, damit sie uns hilft, unsere Erfahrungen in schwierigen Zeiten zu artikulieren. Eingesperrt in eine Zelle in der Lubjanka, die gleichsam sein »Zauberberg« wurde, wandte sich Wat gegen die Idole seiner Jugend, gegen Marinettis »Parole in libertá«. Zu Miłosz sagte er, es gehe weniger darum, »den Sinn eines jeden Wortes als vielmehr das Gewicht eines jeden Wortes zu entdecken«. Das ist eine immer noch aktuelle Kritik an den Frivolitäten der bis heute vorherrschenden literarischen und philosophischen Kultur, die sich in der Relativierung des Begriffs der Wahrheit auslebt. Wat war nicht nur ein »Zeitzeuge« unter Hunderten anderer, die ihre – mitunter zutiefst ergreifenden und eminent wichtigen – Erinnerungen aus der Zeit des Hitlerismus und des Kommunismus aufschrieben, er war mehr, er war auch Denker und Kritiker, er nutzte die Zeit nach dem Gefängnis, um seine Erlebnisse zu durchdenken, er suchte in jeder Lektüre (und er las viel) eine Antwort auf grundlegende Fragen; deshalb konnte er andere inspirieren. Die sowjetischen Gefängniswärter ahnten nicht, wen man ihnen anvertraut hatte …
»Mein Jahrhundert« ist auch deshalb lebendig geblieben, weil es nie als historisches Werk, als Synthese des Wissens über den Kommunismus gedacht war (wenngleich Wat gelegentlich von einer solchen summaträumte); natürlich ist der Kommunismus ein Thema, aber mehr in der Art, wie es für Jonathan Swift die Länder sind, die sein Protagonist in »Gullivers Reisen« besucht. Wat schreibt über sich, über seine Erfahrungen, sein Leben und »sein Jahrhundert«. Er selbst war ein barocker Mensch (wie auch seine Lyrik barock ist), um so intensiver empfand er die Seltsamkeit und das Grauen des zwanzigsten Jahrhunderts. Von niemandem läßt sich sagen, er sei »für das zwanzigste Jahrhundert geboren« (das wäre eine Beleidigung), am wenigsten aber wohl von Aleksander Wat … Er, der gern erwähnte, daß zu seinen Vorfahren der berühmte Rabbiner Raschi aus Troyes (1040–1105) gehörte, einer der wichtigsten Talmud-Deuter des Mittelalters, war eher in früheren Zeitaltern als in Stalins Epoche heimisch. Ist es aber nicht so, daß gerade Reisende, die sich in der Zeit, über die sie schreiben, nicht zurechtfinden, sie am klarsten sehen, weil sie die meisten ihrer Vorurteile nicht teilen? Hier könnte man widersprechen: Das sei Unsinn, der junge Wat sei doch geradezu aufgegangen in den Vorurteilen seiner Zeit, und auch im mittleren Alter sei er alles andere als nonkonformistisch gewesen! Das stimmt, aber der späte Wat, der Wat, den wir weitaus besser kennen, den wir lesen und bewundern, war ganz anders, er hatte die Kinderkrankheiten des Geistes überwunden, und diese Metamorphose deckt sich mit der Zeit seiner Wanderung durch den Archipel Gulag.
Wats Memoiren sind launisch. Es geht dem Autor eindeutig nicht um einen dokumentarischen Bericht über seine Gefängnisjahre, vielmehr will er eine gewisse »Merkwürdigkeit des Daseins« im zwanzigsten Jahrhundert festhalten und dem Leser vermitteln. Er rät dazu, sich vom Feind loszureißen, und folgt auch selbst dieser Maxime: Selbst sein Erzählen »reißt sich vom Feind los«. So lesen wir etwa von der sprachwissenschaftlichen Marotte des Schriftstellers Jewgenij Dunajewskij, eines Zellengenossen in der Lubjanka, die ein mehr auf eine Reportage eingestellter Schreiber wohl übergangen hätte, um sich auf Vordergründiges zu konzentrieren. Wir lesen einen nachträglich eingefügten Abschnitt über Machiavelli (nicht der ganze Text basiert auf Tonbandaufzeichnungen, Wat hat später Ergänzungen vorgenommen), der eigentlich unnötig und auch weniger geistreich ist als andere Kapitel des Buches, wir finden einen kurzen Abschnitt über einen Zuckerwürfel, einen anderen über sowjetische und nichtsowjetische Gesichter sowie zahlreiche Anmerkungen zur Dichtkunst. Das große Paradox von »Mein Jahrhundert« liegt aber darin, daß selbst diese Einschübe, deren Vorhandensein man als Kompositionsschwäche des Buches ansehen könnte, ihm zum Vorteil gereichen; die mäandernden Windungen der Erzählung tragen nämlich wesentlich zur Entstehung eines originellen, plauderhaften, sarmatischen, barocken, kühnen, radikal subjektiven und in nichts an die Linearität ordentlicher politologischer Arbeiten erinnernden Ganzen bei.
Beim erneuten Lesen von Wats Buch bin ich immer wieder auf so originelle und geradezu idiomatische, die Grenzen der politischen Berichterstattung weit überschreitende Bemerkungen gestoßen, daß mir ein Vergleich mit fachwissenschaftlichen Arbeiten einfach sinnlos vorkommt. Beginnen wir mit Wats Verhältnis zum Kommunismus: Einerseits war er in den zwanziger Jahren von ihm infiziert, hatte ihn und alle organisatorischen und mentalen Geheimnisse von der Pike auf gelernt, er kannte den Typus des intellektuellen Funktionärs und auch den des ungebildeten, fanatischen, oft rechtschaffenen und uneigennützigen Mitglieds der Bewegung. Andererseits entwickelte er eine so distanzierte, so ironische Einstellung zum System, daß er sich darin wie ein unfehlbarer Entomologe bewegen konnte, der nicht vergaß, daß er einst selbst ein Insekt war (in diesem Sinne wäre Aleksander Wat das ideale spiegelbildliche Gegenstück zu Gregor Samsa, dem unglücklichen Protagonisten von Kafkas »Verwandlung«). Wenn er etwa anmerkt, welch große Bedeutung der Gesang – im Chor oder solo – im russischen Kommunismus hatte und daß die einfachen Leute, die Durchschnittsrussen, ständig Lieder summten und sangen (oftmals wirklich schöne, bewegende Lieder, weitaus schöner als das System, das sie besingen sollten), und wenn er sagt, er selbst sei für den Reiz dieser allgegenwärtigen Sangeskunst nicht unempfänglich gewesen, dann wissen wir: So etwas konnte nur ein innerlich freier Mensch bemerken, ein Dichter, der für alle erdenklichen Facetten des menschlichen Daseins offen ist, ein im höchsten Maße unorthodoxer Beobachter.
Unorthodox und sogar stark eklektisch: Sowohl in seiner Lyrik als auch in der Prosa zeigt sich Wats Abneigung gegen klare ideologische oder religiöse Entscheidungen. Er war Jude durch Abstammung, aus Sympathie und bis zu einem gewissen Maße auch aufgrund seiner Bildung, er war stolz, daß der große Raschi zu seinen Urahnen zählen mochte, aber er war auch ein polnischer Katholik, der seinem streng katholischen Kindermädchen verbunden blieb; er war Futurist und schätzte zugleich die europäische Kunsttradition, er übersetzte Tolstoi und Dostojewski, las Philosophen, Mystiker und reaktionäre Autoren des neunzehnten Jahrhunderts, kannte die alte Malerei. Wat verspürte nicht das Bedürfnis zu selektieren; als habe die Erfahrung des Kommunismus mit seiner Basis strenger Selektion, strenger Elimination, unaufhörlicher neurasthenischer Suche nach dem rechten Glauben und Verachtung für alle von der Partei verworfenen Ideen ihn eine dem Kommunismus konträre Weisheit gelehrt: Nicht die Ismen sind wichtig (Brodsky scherzte – auf englisch – gern, jeder »ism« werde schnell zum »wasm«), sondern der freie Blick durch die vielen Fenster, die sich zur Welt auftun. Die verschiedenen Traditionen waren für ihn Bestandteile eines Ganzen, und die Einheit dieses Ganzen wurde durch die Persönlichkeit des Schriftstellers gewährleistet, nicht umgekehrt! Wat sagt überdies, eines der Hauptziele des Kommunismus habe in der Zerstörung des inneren Menschen bestanden – und im demonstrativen Eklektizismus seines Denkens manifestiert sich dieser innere Mensch, der sich nicht selbst reduziert, sondern die eigenen Widersprüche duldet.
Wat war ein besonderer Reisender: Er bereiste das kommunistische Rußland während des Zweiten Weltkriegs ganz anders als etwa der berühmte Marquis de Custine im neunzehnten Jahrhundert das Zarenreich. Offen gesagt reiste er kaum, eigentlich nur von Gefängnis zu Gefängnis (der Marquis hatte die zaristischen Gefängnisse nicht kennengelernt, er bewegte sich meist von einem Salon zum anderen); er glich einem Forscher, der sein Labor nicht verläßt und nur Materialproben der Außenwelt entgegennimmt. Er liefert wunderbare Beschreibungen von Menschen, die in sowjetischen Gefängnissen einsaßen, in der berüchtigten Lubjanka oder in Saratow. In der Lubjanka, aber auch in Saratow – wo er selbst unter dem Gefängnispersonal einige barmherzige Menschen fand – verbrachte Wat ein paar Monate in relativer Ruhe; Rußland (oder auch Polen – damals gab es viele Polen im Archipel Gulag) kam zu ihm in die Zelle, und er, gleichsam ein unbeweglicher Zuschauer in einer sehr speziellen Variante der Platonschen Höhle, betrachtete das anthropologische Panorama der großen Katastrophe und ließ Jahre später mit Hilfe seines außergewöhnlichen Gedächtnisses Dialoge und Situationen wieder aufleben. Einige der Häftlinge, denen er dort begegnete, machten auf den Autor großen Eindruck – etwa der russische Kommunist Mischa Tajz, dessen innere Freiheit und dessen Mut Wat bewunderte. Für uns Nachgeborene ist es überraschend, daß sich im Bauch des stalinistischen Wals, in den Zellen der makabren Lubjanka ein derart intensives Leben abspielte, ein Leben, das sich in Gesprächen, Freundschaften und Lektüren manifestierte, in dem man von anderen beeinflußt werden, lernen, sogar innerlich wachsen und kurze Momente der Ekstase erleben konnte, wie Wat, als er auf dem Gefängnisdach Bach hörte. Dabei sollte der Leser nicht vergessen, daß nur wenige Insassen die Haft überlebten, die gewaltige Mehrheit wurde vom Sowjetsystem zermalmt. Als Stalin nach Hitlers Angriff auf die UdSSR die Gründung einer polnischen, hauptsächlich aus begnadigten Gulag-Häftlingen zusammengesetzten Armee erlaubte, waren Polen für einige Monate privilegiert.
Im Lichte von Platons Höhlengleichnis wirkt Aleksander Wat tatsächlich wie ein Philosoph, wie jemand, der entschlossen ist, trotz allem nicht aufzugeben, er selbst zu bleiben, zu lesen, zu denken. Wir staunen über den Reichtum der Gefängnisbibliothek, die Wat eifrig nutzte – unter anderem las er in sowjetischer Haft Augustinus und Solowjow.
Sind Wats Erinnerungen absolut wahrheitsgetreu? Sicher nicht, sicher bewirkten die Jahre der Reflexion nach Kriegsende und die »Abenteuer« in der Sowjetunion (als Krankenhäuser an die Stelle der Gefängnisse traten), daß sein Verstand die Erinnerungen bearbeitete, formte, vielleicht auch ein wenig zurechtbog. Dennoch kann der Leser von »Mein Jahrhundert« gewiß sein, es mit einem zwar barocken, phänomenal ausschweifenden, aber keineswegs erfundenen Buch zu tun zu haben. Wat bekennt sich sogar zu seinen Schwächen – das ist immer schwer, psychologisch fast unmöglich –, etwa wenn er über die Verhöre spricht, denen er unterzogen wurde: »Vielleicht habe ich zuviel geredet.«
Nicht alle polnischen Leser waren von Wats Buch begeistert. Kritik kam vor allem von seinen Altersgenossen. Man warf ihm vor, er habe die Ereignisse, an denen er beteiligt war, nicht immer glaubwürdig dargestellt. Das betrifft vor allem die Schilderung und Wertung der »Lemberger Provokation«, mit der Wats Weg durch Haft und Verbannung begann. Umstritten ist auch seine Darstellung von Kazimierz Wiącek, dem Polnischen Gesandten in Alma-Ata (sie findet sich im Schlußteil des Buches). Überdies erregt Wats Buch schon lange den Unwillen konservativer Milieus, die den Autor für eine moralisch fragwürdige Gestalt halten, weil er in seiner Lemberger Zeit mit den sowjetischen Behörden kollaborierte (worüber er freilich selbst ausführlich spricht). Einer der führenden Intellektuellen des polnischen Exils, der in der Nähe von Paris lebende Jerzy Giedroyc (1906–2000), Herausgeber der Zeitschrift »Kultura« und Chef des gleichnamigen Verlags, ein Mann, der sein Unternehmen mehr als fünfzig Jahre mit eiserner Hand leitete – und auf diese Weise eine immens wichtige Alternative zu den der Zensur unterliegenden Institutionen in Polen schuf, ein Forum für viele im Exil lebende Autoren, darunter Czesław Miłosz und Witold Gombrowicz, Zbigniew Herbert und Józef Wittlin –, entdeckte in Wats Buch problematische »Ungenauigkeiten« und nahm es nicht in sein Programm auf. Aus diesem Grund erschien »Mein Jahrhundert« schließlich in London und nicht in Paris, wenngleich dort, zwischen den Büchern von Miłosz und Herling-Grudziński, sein natürlicher Platz gewesen wäre. Miłosz hält in seiner Rezension von Giedroycs Autobiographie diese »Ungenauigkeiten« für weniger ausschlaggebend als den persönlichen Konflikt zwischen Wat und Giedroyc, der auch nach Wats Tod bestehen blieb.
Ich erwähne diese Vorwürfe, um zu zeigen, vor welchem Hintergrund »Mein Jahrhundert« gelesen werden kann. Politische oder gar »parteiische« Kritik kann dem Buch nichts anhaben. Aleksander Wat machte keinen Hehl aus seiner kommunistischen Vergangenheit; er litt an ihr und sah in der politischen Schuld sogar die Ursache seiner schlimmen Krankheit. Es ist gut möglich, daß er in seinen Erinnerungen jemandem Unrecht tat. Und doch zeugen die politischen Angriffe gegen ihn – übrigens nicht nur in diesem Fall – meist von völliger Blindheit für die literarische – und menschliche – Qualität des Werks. Seltsamerweise kommt diese Art von politischer Rache meist von wenig (oder gar nicht) talentierten Autoren, die ihre Kräfte gleichwohl auch in der Literatur statt bloß in der politischen Publizistik ausleben wollen … Aleksander Wat fliegt in seinen Gedichten und in »Mein Jahrhundert« zu hoch, als daß sein Ruf Schaden nehmen könnte; die Flugabwehrgeschütze seiner Gegner reichen nicht an ihn heran.
Wenn man sich aber überlegt, was für Wat in den Gesprächen mit Miłosz auf dem Spiel stand, erkennt man die Brisanz der Sache. Wir dürfen nicht vergessen, daß er starb, ohne zu wissen, ob »Mein Jahrhundert« je das Licht der Welt erblicken würde; die Tonbänder waren noch nicht transkribiert, das Buch existierte noch nicht. Er mußte fürchten und fürchtete bestimmt, er werde nichts von der Art hinterlassen, was man mit Stanisław Ignacy Witkiewicz als »Hauptwerk« bezeichnen könnte. Es gab sicher bittere Tage, an denen er sich für einen gescheiterten, unproduktiven Schriftsteller hielt. Er konnte den Erfolg seines Buches nicht vorausahnen. Und letzten Endes ging es für Wat um sehr viel mehr als nur um literarischen Nachruhm: In den Gesprächen mit Miłosz stand er vor einer äußerst schweren Aufgabe – er wollte sein ganzes Leben neu definieren. Kürzlich erschien im Rahmen einer polnischen Werkausgabe ein dicker Band mit Wats Publizistik. Von den 840 Seiten dieses Bandes entfällt ein großer Teil auf Texte, die Wat – unser Wat, der späte Wat – sicher am liebsten vernichtet hätte, geschrieben von einem Menschen, der an den Kommunismus glaubte und sich des kommunistischen Jargons bediente, vielleicht auch so tun mußte, als akzeptiere er diesen Jargon oder wenigstens die wichtigsten ideologischen Akzente. Diese Skizzen und Notizen entstanden im russisch besetzten Lemberg noch vor der Verhaftung und nach 1946, obwohl Wat seinem geneigten Zuhörer Miłosz und durch diesen auch uns, den Lesern, mehrfach versicherte, er sei als entschiedener Antikommunist aus der Verbannung zurückgekehrt und habe dem Druck der Machthaber nicht mehr nachgegeben. Kann man aber das Wort »mußte« auf den menschlichen Geist anwenden?
In dem gemeinsam mit Miłosz geschaffenen Buch unternimmt Wat den verzweifelten Versuch, sein ganzes Leben in der Literatur und der Geschichte zu retten, er wechselt die ideologischen Vorzeichen vor den einzelnen Etappen seines intellektuellen Werdegangs. Ein feindseliger Leser könnte sagen (mancher tat es), Wat lüge in »Mein Jahrhundert«, er erfinde, idealisiere, färbe die eigene Geschichte schön, und man könne ihm nur glauben, wenn er von der Sehnsucht nach seiner Frau und seinem Sohn spreche. Ich aber bin Wat wohlgesonnen; nein, Wat lügt nicht. Er färbt schön, ja. Doch das Wort »schönfärben« trifft den Kern der Sache auch nicht. Es handelt sich um das Bekenntnis eines Zeitgenossen oder eher um etwas noch Interessanteres als ein Bekenntnis – eine unerhörte, außergewöhnliche intellektuelle Tat. Wat lügt nicht. Er spricht so, wie es ihm seine Weisheit diktiert, seine bittere, traurige Weisheit, die er in Haft und Verbannung erwarb, in den stalinistischen Nachkriegsjahren in Polen, in Krankenhäusern und den bescheidenen Wohnungen des Pariser Exils. Wat nutzt die Redefreiheit, die ihm der Westen bietet, und die Gegenwart des ihm zugeneigten Miłosz, er konstruiert sich neu, wobei er aus den Reflexionen der vorangegangenen zwanzig Jahre schöpft. Und er weiß genau, daß ihm nicht viel Zeit bleibt, daß er nur noch diese eine Chance hat, daß er krank ist und ohne einen so besonderen Zuhörer im Leiden, in der Ohnmacht der Krankheit ertrinken würde. Also lügt er nicht. Im Gegenteil, er greift nach den Schichten und Reserven seines Intellekts und seiner Seele, die für ihn die wahrhaftigsten und wichtigsten waren, hervorgegangen aus den schwierigsten Momenten seiner Biographie. Hier erneuert sich der menschliche Geist, der scharfsinnige Geist Aleksander Wats, und zwar nicht in narzißtischer Selbstbespiegelung, sondern in einer großmütigen Kaskade von Beobachtungen zur dunklen Geschichte und Kultur des zwanzigsten Jahrhunderts oder, mit anderen Worten, zur Moderne, dieser in unseren Regionen vorübergehend etwas sanfteren Substanz, in die wir noch immer eingetaucht sind.
Wenn ich »Mein Jahrhundert« wohlwollend lese, dann nicht, weil mich anderes für Wat eingenommen hätte, etwa seine Gedichte – obwohl mich natürlich seine Gedichte für ihn eingenommen haben –, oder weil ich seine Frau Ola kannte, die mich durch ihre Anmut für sich einnahm, und seinem Sohn Andrzej begegnete (ja, dem sehnsüchtig vermißten Sohn, der heimlichen Hauptfigur des Buchs). Das Buch selbst nimmt mich für sich ein; dieser Erneuerungsakt eines scharfsinnigen Geistes, der sich gleichsam vor unseren Augen vollzieht, während sie über die schwarzen Buchstaben gleiten, hat mich komplett überwältigt, und das gleich zweimal, bei der ersten Lektüre vor Jahren und auch jetzt, wo so vieles anders ist, wo ich sehr viel mehr über das zwanzigste Jahrhundert und über Aleksander Wat weiß, wo ich kein rebellischer junger Dichter mehr bin, was nicht heißt, daß mir Zweifel und Dilemmata heute fremd wären. Seine Beobachtungen und Analysen haben mich überwältigt, aber auch seine Abschweifungen und Launen.
Denn Aleksander Wat war kein Held, er war kein Dietrich Bonhoeffer des Kommunismus; in Wirklichkeit war er nicht frei von Konformismus. Die Polen, die eine Schwäche für (leider ästhetisch meist fragwürdige) Denkmäler haben, weil es leichter ist, einen Blick auf eine Bronzestatue zu werfen als ein Buch zu lesen, errichten Wat kein Denkmal. Dabei war er bestimmt frei von Dummheit. Er war von Jugend an ein hervorragender Schriftsteller, ein Intellektueller, doch in den sowjetischen Gefängnissen war er ein Everyman, er teilte die Zelle mit anderen Intellektuellen, aber auch mit einfachen Leuten, mit einem Chauffeur, mit russischen Kriminellen. Der NKWD wußte anscheinend nicht recht, was man mit ihm machen sollte. Zum Helden oder eher Märtyrer machte Wat die schreckliche Krankheit, die sich in unerträglichen Schmerzen äußerte. Und so bleibt er uns in Erinnerung, so entstand der Mythos Aleksander Wat – wahrhaftig wie die meisten Mythen.
Heutige Leser von »Mein Jahrhundert« werden wohl besonders die »metaphysischen« Episoden interessieren – Bachs »Matthäuspassion« auf dem LubjankaDach und, wichtiger noch, die Teufelsvision im Gefängnis von Saratow, die zu Wats Bekehrung führte. Wat rekonstruiert seine Vergangenheit im Modus der von Tag zu Tag wachsenden Erfahrung, aber auch im Modus der Ekstase. Jeder Lyrikleser erkennt in diesem Dualismus die Materie des geistigen Lebens, das sich immer zwischen dem Kontinuum der Erfahrung und sprunghaften ekstatischen Erlebnissen entfaltet. Zugleich wird einem aufmerksamen Leser nicht entgehen, wie wichtig Czesław Miłoszs wache Gegenwart ist. Auf der anderen Seite des Tisches mit dem Aufnahmegerät, dessen Spulen sich geduldig drehten, saß nämlich kein Journalist, kein Interviewprofi, der auf Bestellung mit Politikern, Priestern oder Ökonomen spricht, sondern ein Dichter, ein Magier der Vorstellungskraft. Daß sich in Wats Buch, das herrlich und heterogen ist wie alle umfangreichen und ambitionierten Werke, wahrhaft inspirierte Passagen finden, ist in großem Maße Miłosz zu verdanken. Wenn zwei große Dichter an einem Tisch sitzen, müssen früher oder später Kristalle der Inspiration zu leuchten beginnen …
Aus dem Polnischen von Bernhard Hartmann
SINN UND FORM 6/2014, S. 760-784