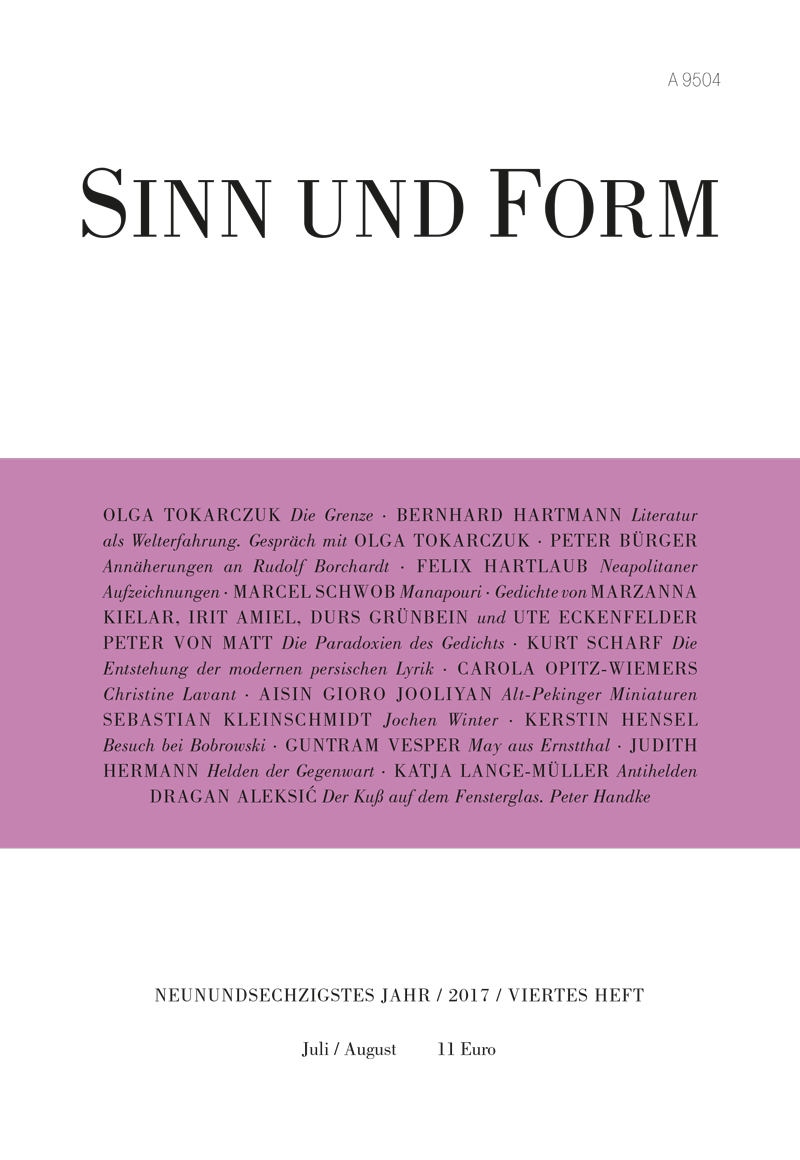Leseprobe aus Heft 4/2017
Scharf, Kurt
»Halt aus in der Nacht bis zum Wein«
Die Entstehung der modernen persischen Lyrik
Um die Bedeutung des Bruchs mit der Tradition zu erfassen, den die modernen iranischen Lyriker vollzogen, müssen wir zumindest einen kurzen Blick auf die Geschichte der persischen Dichtung werfen. Wie die deutsche, so hat auch die Entwicklung der persischen Sprache drei Etappen durchlaufen. Will man jedoch zu ihren Ursprüngen gelangen, so muß man, um mit Thomas Mann zu sprechen, sehr viel tiefer in den Brunnen der Zeit hinabsteigen als bei unserer Muttersprache. Die älteste uns erhaltene Literatur in persischer Sprache ist geistliche Lyrik. Es sind die Gathas, die Zarathustra vor vermutlich etwa dreitausend Jahren verfaßt hat und die uns zunächst mündlich, später auch schriftlich im Âwestâ, dem heiligen Buch seiner Anhänger, überliefert worden sind.
Diese Phase endete im 4. Jahrhundert v. Chr. mit der Eroberung des achämenidischen Weltreiches durch Alexander den Großen. Unter ihm und seinen Nachfolgern wurde Griechisch vorübergehend zur Hauptsprache des Reichs.
Aber später erhielt das Persische, nunmehr in veränderter Form, seine Bedeutung zurück. Es entwickelte sich eine reiche mittelpersische Literatur, zu der unter anderem der Kern der Märchen aus Tausendundeiner Nacht gehört. Erst später wurden sie ins Arabische übertragen und durch arabische Erzähler erweitert. Der bekannteste Lyriker dieser Epoche war ein Dichter namens Barbad, der um 600 n. Chr. am Hofe des Sassanidenkönigs Chosrou Parwis lebte. Er erfand eine Gedichtform, die er zu Ehren des Herrschers Chosrowâni nannte.
Nach der Eroberung des Reichs durch die Muslime im 7. Jahrhundert n. Chr. wurde das Persische zunächst aus dem öffentlichen Raum verdrängt, aber nie vergessen, so daß es nach etwa zwei Jahrhunderten seine alte Stellung als Amts- und Literatursprache, nunmehr jedoch mit arabischem Alphabet und angereichert mit zahlreichen arabischen Lehnwörtern, zurückgewinnen konnte.
Die neupersische Literatur begann mit Rudaki im 9. Jahrhundert n. Chr. im Nordosten Irans in Chorassân, das seitdem als Wiege der Dichtkunst gilt, also etwa zu der Zeit, in der das althochdeutsche Hildebrandslied verfaßt wurde. In der klassischen Periode, d. h. bis zu Dschâmi, der im 15. Jahrhundert ebenfalls in Chorassân lebte, erreichte sie eine Formvollendung, die sie zum beliebtesten literarischen Instrument in einem weiten Kulturkreis machte. Nicht nur auf dem Gebiet der heute persischsprachigen Länder Iran, Afghanistan und Tadschikistan, sondern auch im Süden des asiatischen Teils der ehemaligen Sowjetunion, in Pakistan, einem großen Teil Indiens und dem Irak sowie am osmanischen Hof war Persisch die Sprache der Lyrik.
Einzelne Vertreter dieser Kunst wurden aber auch im Abendland bekannt. Das gilt etwa für Omar Chayyâm, den Dichter aus Chorassân, dessen Vierzeiler vor allem durch Edward Fitz Geralds Übersetzungen weltweit berühmt geworden sind. Ein Beispiel sei hier zitiert:
Ich sah den Töpfer, der in seiner Werkstatt stand
Die Töpferscheibe drehend formte er den Rand
Von einem Krug, dann auch den Henkel aus dem Lehm
Von eines Königs Schädel, eines Bettlers Hand.
Um den Doppelsinn zu erfassen, muß man sich vor Augen halten, daß das persische Wort für »Töpferscheibe« vieldeutig ist; es kann auch für das Rad des Schicksals oder den Kreislauf des Weltgeschehens stehen.
Weltruhm erlangte auch der Schiraser Dichter Sa’adi. Folgende Verse von ihm stehen über dem Haupteingang des Gebäudes der Vereinten Nationen in New York:
Ein Glied desselben Leibes ist ein jedes Menschenkind
Weil von derselben Wesensart wir alle sind
Und trifft ein Schicksalsschlag ein Glied im Lauf der Zeit
So spüren alle seine Glieder dieses Leid
Wenn dich das Unglück anderer nicht quält
Dann ist der Name »Mensch« für dich verfehlt.
Als Höhepunkt gilt das Werk von Hafis, dem Goethe im »West-östlichen Divan« gehuldigt hat. Das liegt einerseits an seiner scheinbar mühelosen Beherrschung aller sprachlichen Mittel. Aber auch sein dialektischer Umgang mit Regeln und seine Fähigkeit, noch ausgeklügelter als Omar Chayyâm auf mehreren Ebenen gleichzeitig zu argumentieren, spielten dabei eine Rolle. Betrachten wir zwei Zeilen seiner Dichtung, um zu sehen, was damit gemeint ist:
Ich möchte einen starken Wein, der trunken macht sogar den stärksten Mann,
Daß ich für einen Wimpernschlag die Unrast dieser Welt vergessen kann.
Hafis’ Werk beruht auf den Regeln der Dichtkunst, und seinem Genie bei ihrer Anwendung ist es vor allem zu verdanken, daß sie in der klassischen Epoche unangefochten galten. Anderen Regeln begegnet er mit Geringschätzung. Schon auf der lexikalischen Ebene brechen diese Verse mit einem Tabu; denn in islamischen Ländern ist der Weingenuß verpönt. Sie enthalten daneben eine literarische Anspielung für den Kenner: Der größte iranische Held, Rustam, liebte nach dem »Königsbuch«, dem um das Jahr 1000 herum von Firdausi verfaßten Nationalepos, den Wein. Aber sie stehen zugleich im Widerspruch zu dieser Überlieferung; denn jener Recke bewies auch dadurch seine Stärke, daß er so viel Wein trinken konnte, wie er wollte, ohne daß ihm dies etwas hätte anhaben können. Die beiden Zeilen haben indessen noch zwei weitere Bedeutungsebenen. Der Wein ist ein häufig verwendetes Symbol für die Liebe, ebenso wie Trunkenheit für Verliebtheit. Liest man den Vers dementsprechend, dann spricht sich in ihm die Sehnsucht des Verfassers nach einem Liebesabenteuer aus, das ihn die Alltagssorgen vergessen läßt. Schließlich ist die sinnliche Liebe auch ein Bild für die übersinnliche, die Liebe zu Gott, und die Trunkenheit für die mystische Einswerdung mit ihm. Man braucht sich nicht für eine Lesart zu entscheiden, vielmehr gehen die verschiedenen Bedeutungen ineinander über und ergänzen sich.
Die Klassiker entwickelten einen poetischen Kanon, der als so vollendet galt, daß niemand ihn zu erweitern wagte. Dazu gehörten gewisse Gedichtformen mit einem Versmaß, das von der ersten bis zur letzten Zeile durchzuhalten war, ein bestimmter Wortschatz, kettenartige Strukturelemente, die jedes Wort einer vorgegebenen Umgebung zuordneten, ein festes Register von Bildern und Metaphern sowie die Gliederung des Gedichts in Beyt und Messrâ (ganze und Halbverse), innerhalb derer ein Gedanke auszudrücken war. Zudem hatten die Gedichte eine Struktur, die den Reimen ganz bestimmte Positionen, besonders häufig nach dem Schema a a b a c a d a usw. zuwies; und meist mußte ein und derselbe Reim durch das ganze Gedicht durchgehalten werden.
Dieser Kanon, die schillernde Vieldeutigkeit und die virtuose Handhabung der poetischen Mittel faszinierten die Leser durch die Jahrhunderte, so daß kein Dichter sich traute, sie aufzugeben. Die Folge war eine gewisse Starre. Die späteren Lyriker glichen, um das bei ihnen besonders beliebte Bild eines paradiesischen Gartens zu verwenden, Gärtnern, die ihre Beete ständig neu arrangierten, es aber nicht wagten, andere Blumen zu pflanzen, geschweige denn den Garten zu verlassen. Entsprechend groß war die Aufregung, als 1921 ein längeres Gedicht mit dem Titel »Afssâne« erschien, dessen Verfasser viele dieser Regeln außer acht ließ. Es enthielt 127 Strophen von je fünf gleich langen Zeilen, von denen sich immer die zweite und die vierte reimen, und war in einem uralten, dem Âwestâ entnommenen Versmaß geschrieben, das längst niemand mehr verwendete. Es war durchaus formstreng, aber die Formen waren ganz und gar ungewohnt und das Thema neuartig. Der Gärtner hatte also exotische Blumen angepflanzt und auf Methoden einer längst vergangenen Tradition zurückgegriffen. Aber auf die traditionelle Vieldeutigkeit wollte auch Nimâ Yuschidsch, wie der Verfasser sich nach seinem Geburtsort Yusch nannte, nicht verzichten. Den Titel kann man als Frauennamen lesen, aber auch als »Märchen« oder »Phantasie«; und der Inhalt läßt sich ebenso als Ausdruck tiefen Liebeskummers verstehen wie als Lied eines Patrioten, der über die Lage seiner Heimat verzweifelt ist. Um eine Vorstellung davon zu vermitteln, sei hier zumindest eine Strophe zitiert:
Das Mitgefühl stieg dir zu Kopf wie Wein
Und mit Afssâne ließest du dich ein
Die ganze Welt flieht stets vor ihr
Du machtest dich mit ihr gemein.
Elend ist sie wie du und findet keinen sonst.
Damals erlebte Iran eine Phase des Umbruchs, der Thron des alten Kaiserhauses, der Qadscharen, wankte, und der neue Herrscher Resâ Schâh war noch nicht etabliert. Aber bald darauf wurde die dekadente Dynastie der absoluten Monarchen durch eine nur notdürftig als Monarchie verkleidete Militärdiktatur mit einer äußerst strengen Zensur abgelöst. So ließ der neue Schah dem Dichter Mirsâ Mohmmad Farrochi Yasdi, der immer wieder gegen ihn polemisiert hatte, den Mund zunähen, ein bis heute in Iran unvergessenes Vorgehen. Es herrschte folglich kein günstiges Klima für Meinungsstreit und literarische Experimente. So dauerte es denn auch zwei Jahrzehnte, bis Nimâ Yuschidsch, mit bürgerlichem Namen Ali Essfandiâri (1897 –1960), den nächsten Schritt in seinem Reformwerk tun konnte. Nachdem Briten und Sowjets Resâ Schâh, der sein Land aus dem Zweiten Weltkrieg hatte heraushalten wollen, 1941 zum Rücktritt gezwungen und zunächst nach Mauritius, später nach Südafrika verbannt hatten, entstanden sofort vier große und eine ganze Reihe kleinerer literarischer Zeitschriften. In ihnen veröffentlichte Nimâ, wie die Iraner ihn meist liebevoll bei seinem angenommenen Vornamen zu nennen pflegen, gänzlich neue Gedichte. Er überstieg nunmehr, um das oben benutzte Bild noch einmal zu verwenden, die Mauer des Gartens, suchte außerhalb gelegene Felder auf und begann Landwirtschaft statt Gartenbau zu betreiben: Seine neue Lyrik war von der Natur seiner engeren Heimat am Rande des Kaspischen Meeres inspiriert, einer an Wald und Wasser reichen Gegend mit fruchtbaren Äckern, die in schroffem Gegensatz zum trockenen Wüstenklima des iranischen Hochlandes steht. Es ist sicher kein Zufall, daß gerade ein Mann dieses Landstrichs das Ideal des in einer Oase am Rande der Wüste gelegenen Paradiesgartens aufgab. Er verwendete neue Metaphern und verwarf die Rollen, die den einzelnen Wörtern der Überlieferung nach zukamen, ging aber auch in der Grammatik neue Wege. Dadurch gewann er dichterische Freiheit, aber gab auch all das auf, was sich seine Vorgänger im Laufe von zwölf Jahrhunderten erarbeitet hatten. Das Ergebnis war eine frische, überraschende Ausdrucksweise in einem ungewohnten, oft aber auch ungehobelt und linkisch wirkenden Stil. Ähnlich radikal verfuhr er mit den poetischen Formen. Er schrieb weder Gaselen noch Qassiden oder Vierzeiler wie Omar Chayyâm; seine Gedichte sind vielmehr frei gestaltet. Zwar verzichtete er nicht ganz auf Reim und Versmaß, aber die Reime hatten bei ihm keinen festgelegten Ort mehr, sondern wurden über das Gedicht verteilt, ab und zu standen sie nicht einmal mehr am Ende der Zeile, sondern mitten im Vers. Das Metron wurde zwar weiterhin von dem einmal gewählten Versmaß bestimmt, aber die Anzahl der Versfüße variiert, so daß Zeilen von ganz unterschiedlicher Länge entstanden. Die einschneidendste Veränderung war jedoch der neue Inhalt seiner Lyrik. Er benutzte die Feder als Schwert und stellte die Dichtung in den Dienst seines politischen Ideals von Solidarität und Gleichheit. Da die relative politische Freiheit, die 1941 herrschte, nicht von Dauer war, mußten die Dichter, die für gesellschaftliche Veränderungen eintraten, sich bald einer verschlüsselten Sprache bedienen, um die neue Zensur zu unterlaufen. So schrieb der Kommunist Nimâ, der den politischen Umsturz durch Mao in China begrüßte: »Nicht umsonst sind die Gelben rot geworden. / Die Röte hat die Mauer / nicht umsonst gefärbt.« Und er beklagte die schlechte Lage seines Heimatlandes im Vergleich zur Sowjet union: »Trocken ward mein Acker / Neben dem Feld des Nachbarn.« Wenn er von »Nacht« sprach, meinte er die finsteren Verhältnisse unter dem letzten Pahlawi-Schah, und die »Morgenröte« war die ersehnte Veränderung. Die »Nachtigall« war nun nicht mehr der Liebende, der seine Geliebte, die »rote Rose«, besang, sondern ein Verkünder neuer Ideen; und die Rose konnte jetzt die Revolution bedeuten.
(…)
SINN UND FORM 4/2017, 503-520, hier S. 503-507