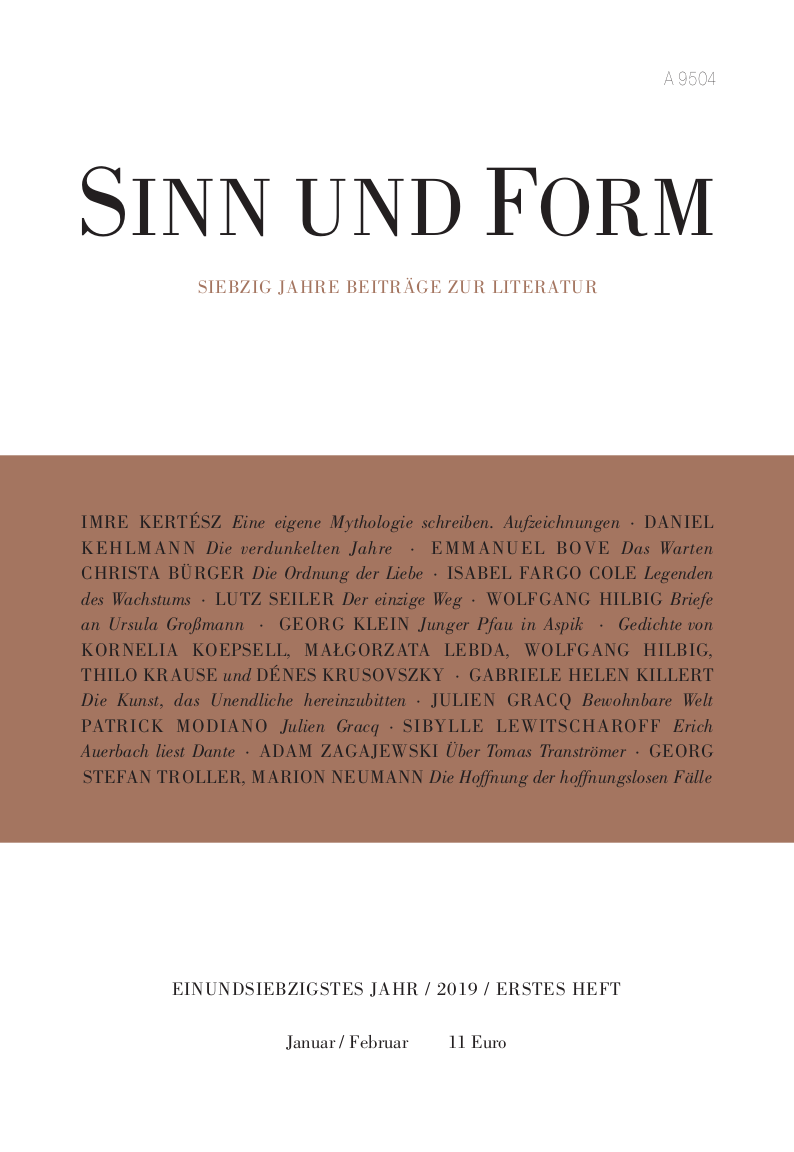
[€ 11.00] ISBN 978-3-943297-45-4
Printausgabe bestellen[€ 8,00]
PDF-Ausgabe kaufenPDF-Download für Abonnenten Sie haben noch kein digitales Abo abgeschlossen?
Mit einem digitalen Abo erhalten Sie Zugriff auf das PDF-Download-Archiv aller Ausgaben von 2019 bis heute.
Digital-Abo • 45 €/Jahr
Mit einem gültigen Print-Abo:
Digital-Zusatzabo • 10 €/Jahr
Leseprobe aus Heft 1/2019
Killert, Gabriele Helen
Die Kunst, das Unendliche hereinzubitten. Zur Poetik des literarischen Surrealismus
Die surrealistische Revolution Mitte der zwanziger Jahre in Paris war vielleicht nicht die wichtigste, wohl aber eine der schönsten und unblutigsten aller historischen Revolten. Was ist passiert? Ein paar Priester wurden beschimpft, der Papst ein Hund genannt. Und ein paar Ausstellungsräume und Kinos gingen zu Bruch. Nicht eben viel, wenn man bedenkt, welche Zukunft das »Büro für surrealistische Forschung« über die Menschheit verhängt hatte: Enteignung des Bewußtseins, der Logik, des perfiden Wachzustandes. Und: schöpferischer Schlaf, Mystik, Magie, Hysterie und automatisches Schrei ben – für alle!
Wieder einmal zogen die Proletarier aller Länder nicht mit. Dafür strömte die Boheme aller Länder und Wolkenkuckucksheime in Paris zusammen, um André Breton bei der »Neueinteilung des Lebens« zur Hand zu gehen. So nahm die Bewegung ihren Lauf.
Bei uns kam sie allerdings nie so richtig an. Der literarische Surrealismus hatte in Deutschland erst spät, seit den vierziger Jahren, eine bescheidene, leise vor sich hin bröckelnde Bastion. Weithin unbekannte Namen wie K. O. Götz, Johannes Hübner, Joachim Uhlmann, Lothar Klünner wären zu nennen. Ein Grüppchen, so klein und anfangs gänzlich unsichtbar, daß der Übersetzer Friedhelm Kemp nach 1945 immerhin noch meinte, einen deutschen Surrealisten – Friedrich Umbran – erfinden zu müssen, um einer etwas tristen Nachkriegsanthologie etwas mehr Pep und Farbe zu verleihen: »Unter den süßen Schenkeln / Wenn die Galle der Gärten im Nebel schläft / Und die Teiche wie Bienen sich umsehen …« Mit seinem eigenen guten Namen wollte Kemp dafür lieber nicht geradestehen.
Der deutsche Geschmack hat es gern profund. Ein bißchen schwer, ruhig auch schwerverdaulich. Nur nicht zu leicht, dann wird es schnell frivol. Dadaismus ja. Wo gehobelt wird, fallen Späne. Bei Dada fällt so viel Sprachschrott hinten raus, man merkt, wie fleißig da gearbeitet wurde. Das spricht das deutsche Handwerkergemüt an. Aber Surrealismus? Ziemlich französisch, ziemlich artistisch. Schön vielleicht, aber wozu das Ganze?
Mit solch obstruktiven Sinnfragen wird dem Surrealismus hierzulande das Leben schwergemacht. Betrachten wir zum Beispiel das Gedicht »Steinbläue über dem Dolchschatten« von Anfang der sechziger Jahre: »Weil das Fleisch mit / dem Knochen schläft / rollen Augen über den Tisch / tanzt löwenbeinig / der Tisch übers Meer / öffnet das Meer Fenster / über einem Meer von Gesichtern.«
Das Gedicht verfaßte der Berliner Lyriker Richard Anders, ein Mensch von sanfter Schale, aber rauhem Kern, wenn es darum ging, Breton und den Surrealismus vor der Welt zu verteidigen. Bis zu seinem Tod 2009 hielt er tapfer die Stellung als vermeintlich »letzter deutscher Surrealist«.
In dem kleinen Text werden Dinge behauptet, die nur schwer nachvollziehbar sind. Dieses Gedicht kann sich nicht ausweisen: weder als Sinngedicht noch als lyrisches Stimmungsgedicht. Erst recht nicht als engagiertes, dazu fehlt ihm der angemessen freudlose Ton. Es hat keine Chance, in ein Lesebuch der sechziger Jahre aufgenommen zu werden, neben Verse von Günter Kunert, Erich Fried oder Hans Magnus Enzensberger, denn wo sind hier die sechziger Jahre? Keine Chance, überhaupt in ein Lesebuch zu kommen, denn was soll man hier interpretieren? Es wirkt so leicht, so übermütig, als hätte es gar keine Arbeit gemacht.
Es ist eben ein surrealistisches Gedicht. Ein Stück magische Kunst, die »irgendwie erneut den Zauber zeugt, der sie selbst gezeugt hat«, wie André Breton in »L’art magique« (Magische Kunst) zu definieren versucht hat. Es handelt sich um die schwer faßliche Disziplin des somnambulen Arbeitens. »Der Dichter arbeitet «, ein Schild mit diesem Hinweis stand an der Tür des Surrealisten Robert Desnos, während er schlief und träumte. Die Ressourcen des Innern, des eigenen respektive kollektiven Unbewußten sprudeln zu lassen, darum ging es von Anfang an. Der Surrealismus ist vor allem »ein Zustand des Geistes«, dekretierte Antonin Artaud, der zeitweilige Bürochef der Bewegung. Will heißen, der Surrealist »besitzt keine Gefühle, die zu ihm selbst gehören, er bekennt sich zu keinem Gedanken. Sein Denken errichtet ihm keine Welt, der er vernünftig zustimmt. Er gibt die Hoffnung auf, den eigenen Geist zu treffen. Aber endlich ist er im Geist (…), und vor seinem Denken wiegt die Welt nicht schwer«.
Wie man in diesen Schwebezustand einer ungelenkten Rezeptivität gerät, der die poetische Energie des Unbewußten freisetzt, skizzierte André Breton nach Art einer Gebrauchsanweisung der écriture automatique, des primären jeu surréaliste. Man möge sich in einen quasi meditativen Zustand des Nichtwollens, der Gedankenleere und Absichtslosigkeit versetzen und schnell, ohne Plan und vorgefaßtes Thema drauflosschreiben. »Der erste Satz wird ganz von alleine kommen, denn es stimmt wirklich, daß in jedem Augenblick in unserem Bewußtsein ein unbekannter Satz existiert, der nur darauf wartet, ausgesprochen zu werden. Ziemlich schwierig, etwas darüber zu sagen, wie es mit dem folgenden Satz geht; zweifellos gehört er unserer bewußten Tätigkeit und zugleich der anderen an, (…) gerade darin liegt zum großen Teil der Wert des surrealistischen Spiels.« Man solle sich dabei, betont Breton, ganz auf »die Unerschöpflichkeit dieses Raunens« verlassen. Wenn ein Verstummen sich einzustellen droht, breche man bei einer zu einleuchtenden Zeile ab und setze hinter das suspekt erscheinende Wort irgendeinen beliebigen Buchstaben als Anfang des folgenden Wortes, um so die Willkür wiederherzustellen.
Ausgenommen die theoretischen Texte, wie etwa dieser aus dem ersten surrealistischen Manifest von 1924 – hier mußte zum Bedauern Bretons »in Formeln« statt in Zungen geredet werden –, verdanken wir dieser Technik einer blind agierenden sprachlichen Induktion die frühen Texte des Surrealismus. Entscheidend beim automatischen Schrei ben ist der Verzicht auf Kontrolle. »Denk-Diktat jenseits jeder ästhetischen oder ethischen Reflexion« soll der Text sein. Das Karussell darf sozusagen nicht an der Kasse haltmachen. »Die magnetischen Felder«, Bretons erster, gemeinsam mit Philippe Soupault verfaßter, kanonisch surrealistischer Text – eine lyrisch dramatische Collage aus Kindheitserinnerungen und aggressiv getönten Ängsten, die die Lebenssituation der Freunde nach dem Ersten Weltkrieg spiegeln –, entstand so in automatischer Schreibweise.
Soupault: Ein guter Rat: Gehen Sie in die Avenue du Bois und schenken
Sie einem Mieter dieser Häuser, deren entzückende Geschmacklosigkeit
unsere Leidenschaften erregt, ein bescheidenes Zehnsousstück.
Breton: Wir werden dann den Rückzug der toten Generäle erzwingen können
und ihnen von neuem die Schlachten liefern, die sie verloren haben.
Sonst müssen wir eine Fälschungsklage einreichen gegen die gerechtesten
Urteile der Welt, und das Palais de Justice ist naß.
Soupault: Ich bin dessen nicht so sicher wie Sie. Eine Straßenlaterne, die
ich liebe, hat mir zu verstehen gegeben, daß Generäle und Nonnen den
Verlust der geringsten Träume zu schätzen wissen …
Syntaktisch gesehen scheint die Welt auf den ersten Blick noch in Ordnung. Doch die formale Verknüpfung innerhalb des Textes durch Rede und Gegenrede, das Vertraute rhetorischer Figuren sind trügerisch. Was hier geschieht, gleicht dem Ins-Leere-Reden des Absurden Theaters, das mit Alfred Jarry und Apollinaire beginnt und sich bei Beckett bis zur Selbstauflösung, zum Paroxysmus des Absurden im Schweigen, radikalisiert hat. Die beiden glücklichen Verfasser staunten über den Elan, die Leichtigkeit und die »bemerkenswerte Auswahl derart guter Bilder, wie wir sie bei langer Vorbereitung unfähig gewesen wären hervorzubringen«.
Der assoziative Schwung, die Schubkraft der Bilder ermöglicht ungewöhnliche Konstellationen, wie die »Begegnung eines Regenschirms und einer Nähmaschine auf dem Seziertisch«, die wir dem Vorreiter und Spiritus rector des Surrealismus, Lautréamont, verdanken. Er sprach solchem Schöpfungsakt »konvulsivische Schönheit« zu, die Breton und sein Kreis nunmehr von jedem surrealistischen Akt verlangten. Man könnte hier an Schillers Begriff des Schönen denken als Freiheit in der Erscheinung«. Surrealismus bedeutet aber vor allem: Freiheit in actu. Was Friedrich Schlegel für die Ironie reklamiert – »sie ist die freieste aller Lizenzen, denn durch sie setzt man sich über sich selbst weg« –, gilt auch für die Praxis des jeu surréaliste. Niemand ist freier als der Surrealist, der sich der Willkür des Einfalls, dem Handstreich des Augenblicks überläßt. Dies ist jedenfalls sein Glaube und sein Credo.
(…)
SINN UND FORM 1/2019, S. 106-115, hier S. 106-109
