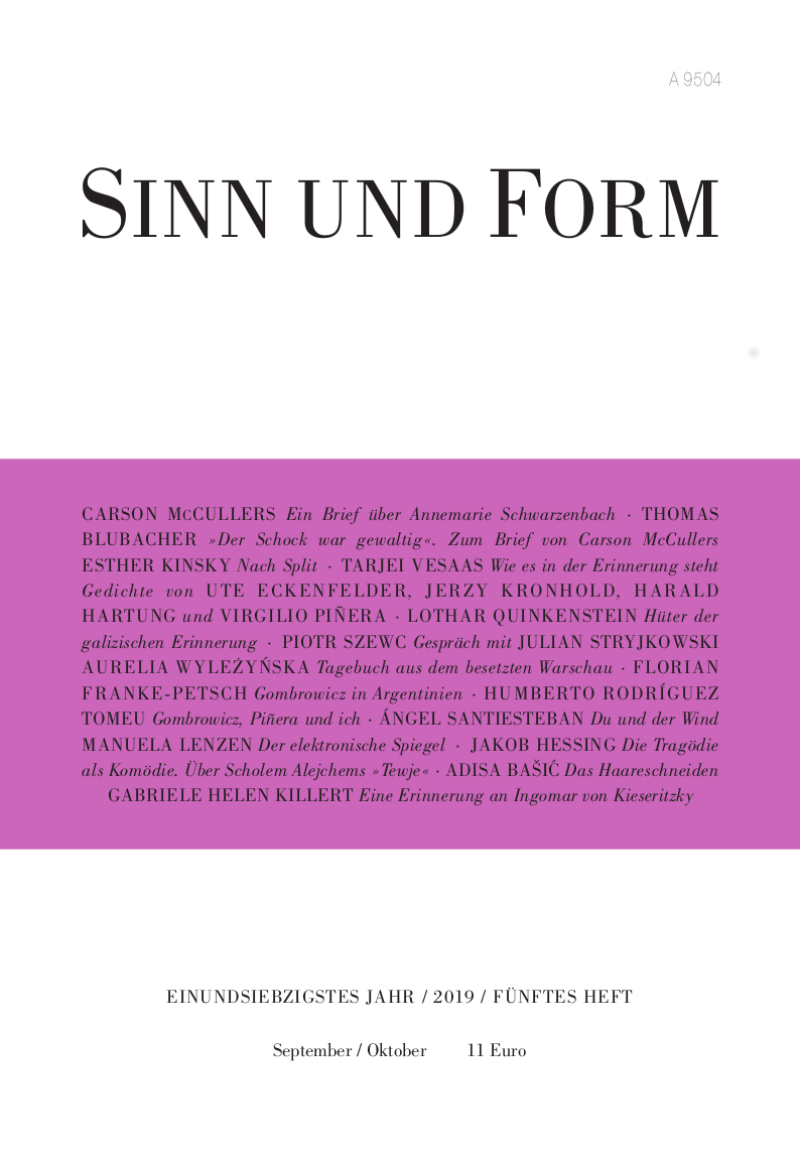
[€ 11.00] ISBN 978-3-943297-49-2
Printausgabe bestellen[€ 8,00]
PDF-Ausgabe kaufenPDF-Download für Abonnenten Sie haben noch kein digitales Abo abgeschlossen?
Mit einem digitalen Abo erhalten Sie Zugriff auf das PDF-Download-Archiv aller Ausgaben von 2019 bis heute.
Digital-Abo • 45 €/Jahr
Mit einem gültigen Print-Abo:
Digital-Zusatzabo • 10 €/Jahr
Leseprobe aus Heft 5/2019
Wyleżyńska, Aurelia
»Über nichts schreiben, als was die Augen sehen«.
Tagebuch aus dem besetzten Warschau (1939)
Vorbemerkung
Als am 1. September 1939 deutsche Truppen Polen überfielen, hatte Aurelia Wyleżyńska sich als Verfasserin mehrerer Romane, eines Parisführers und zahlreicher Beiträge für Tageszeitungen und Zeitschriften schon einen Namen gemacht. Gleichwohl waren es von allen Werken ihre Aufzeichnungen aus den Jahren 1939 –1944, von denen sie hoffte, daß sie für die Nachwelt erhalten blieben. Am 3. April 1944 notierte sie: »Das ist mein Testament … (…) Von Horaz bis Puschkin wollte jeder Schriftsteller sich ein Denkmal setzen. (…) Mein Wunsch ist es, dieses Tagebuch zu veröffentlichen. Zu Lebzeiten oder posthum.«
Das Tagebuch enthält Biographisches, Reflexionen über Kultur und Literatur, vor allem aber Notizen von Streifzügen durch Warschau, die eindrückliche, oft frappierende Bilder vom Leben in der erst belagerten, später besetzten Stadt liefern. Nicht minder aufschlußreich sind die Schilderungen aus der masowischen Provinz, vom Landsitz der Familie in Wielgolas, den Wyleżyńska während des Krieges aufsuchte, wann immer sich ihr die Möglichkeit bot. Ihr klarer, unbestechlicher Blick ermöglichte es der Verfasserin, von Propaganda und Freund-Feind-Denken unbeeinflußte Beobachtungen und Gedanken zu Papier zu bringen. Die Suche nach Informationen über die Vorgänge in Warschau brachte die Autorin mitunter in höchste Gefahr: Eines Tages wäre sie um ein Haar als vermeintliche Spionin standrechtlich erschossen worden – Rettung brachte in letzter Sekunde ein Offizier, der die Schriftstellerin und Journalistin erkannte. Doch auch solche Erlebnisse hielten Wyleżyńska nicht von ihrer Mission ab: »Ich habe beschlossen, die Chronistin dieser von barbarischen Horden zerstörten Stadt zu sein, und muß Dokumente sammeln, wo ich nur kann.«
Schon vor dem Krieg führte Wyleżyńska ein bewegtes, wenngleich nur spärlich dokumentiertes Leben (auch in dieser Hinsicht ist das Tagebuch eine maßgebliche Quelle). Sie wurde 1881 im podolischen Ort Oknica (heute Moldawien) geboren, besuchte renommierte Mädchenschulen in Warschau und Krakau und studierte von 1907 bis 1911 polnische Literatur und Philosophie an der Krakauer Jagiellonen-Universität. Nach Abschluß des Studiums pendelte sie als Reporterin zwischen Paris und ihrem Wohnort Krakau. Im Sommer 1915 wurde sie als österreichische Staatsbürgerin auf Anordnung der zaristischen Armeeführung nach Saratow deportiert, wo sie den angehenden Schriftsteller, Essayisten und Literaturübersetzer Jan Parandowski ("Jasiek«) kennenlernte. 1918 heirateten die beiden und übersiedelten nach Kriegsende in seine Heimatstadt Lemberg, wo Wyleżyńska aktiv am literarischen Leben teilnahm. Nach dem Scheitern der – intellektuell und publizistisch überaus produktiven – Ehe zog sie 1924 nach Paris. Wie schon in Saratow engagierte sie sich dort in exilpolnischen Organisationen und führte einen literarischen Salon. Über ihre Reisen nach Italien, Spanien, Österreich und Deutschland berichtete sie regelmäßig in polnischen Tages- und Wochenzeitungen. Außerdem verfaßte sie mehrere Romane und Erzählbände, deren Protagonistinnen oft gegen überkommene Geschlechterrollen ankämpfen. 1937 zog sie in die polnische Hauptstadt. Der Kriegsbeginn überraschte sie im damals polnisch-rumänischen Grenzort Zaleszczyki (heute Ukraine). Im besetzten Warschau schrieb Wyleżyńska für die Untergrundpresse, ab Mitte 1940 arbeitete sie als Freiwillige in Krankenhäusern der Stadt. Außerdem versorgte sie jüdische Freunde, die sich außerhalb des Ghettos versteckten. In ihrer letzten Warschauer Wohnung veranstaltete sie ab 1942 Literaturabende für einen kleinen Kreis von Freunden, denen sie kurz vor ihrem Tod auch Auszüge aus dem Tagebuch vorlas. Am 2. August 1944, einen Tag nach Beginn des Warschauer Aufstands, wurde Aurelia Wyleżyńska auf dem Rückweg vom Krankenhaus von einer deutschen Kugel getroffen. Am folgenden Tag erlag sie ihren Verletzungen.
Das Tagebuchmanuskript überdauerte den Krieg in der Bibliothek eines Büchersammlers, heute liegen die zum Teil stark beschädigten Blätter im Zentralarchiv für Moderne Akten und in der Nationalbibliothek in Warschau. In geschichtswissenschaftlichen Arbeiten werden immer wieder einzelne Passagen zum Leben in der besetzten polnischen Hauptstadt zitiert, doch liegt bis heute keine Gesamtausgabe vor. Ein Grund dafür sind neben den konkreten editorischen Schwierigkeiten bei der Erstellung einer verläßlichen Textfassung sicher auch die Person und die Haltung Aurelia Wyleżyńskas, die sich ideologisch und geschichtspolitisch nicht vereinnahmen läßt. Der Literaturwissenschaftlerin Grażyna Pawłak vom Institut für Literaturforschung der polnischen Akademie der Wissenschaften und dem Historiker Marcin Urynowicz vom Institut für Nationales Gedenken ist es zu verdanken, daß Ende 2020 die erste polnische Ausgabe des Tagebuchs erscheinen wird – beide arbeiteten bezeichnenderweise jahrelang privat an dem Projekt. Der Berliner Journalist und Historiker Martin Sander möchte das Werk auch deutschsprachigen Lesern zugänglich machen und hat mich als Übersetzer mit ins Boot genommen. Mit der Publikation des vorliegenden Auszugs verbinden wir die Hoffnung, Aurelia Wyleżyńskas Aufzeichnungen eines Tages in einer umfangreicheren deutschen Ausgabe präsentieren zu können.
Bernhard Hartmann
15. August 1939
Ich fahre nach Horodnica, ins Ferienlager des Stefan-Żeromski-Arbeiterinstituts für Bildung und Kultur. Mich interessiert diese noch wenig bekannte Form des Nachkriegszusammenlebens. Alle lachen mich aus, sie sagen, für so etwas müsse man zwanzig sein und eine Garantie auf heiteres Wetter haben. Doch die Gier nach Eindrücken kennt kein Alter. Innerlich bin ich immer heiter. Andere prophezeien einen heraufziehenden Sturm. Ich glaube, dieses Mal zieht er vorüber. Denn ich vertraue auf die Weisheit der Menschheit. Sie wird es nicht wollen, es nicht zulassen … Denn andere, so wie Huxley, so wie ich, haben eine friedliche Lösung für alle drängenden Probleme gefunden.
Horodnica, 20. August 1939
Wie schön es sein wird, befreit von allen Problemen zu schreiben, mit denen ich mich in letzter Zeit beschäftigen mußte. Schildern, was ich sehe, mich begeistern, nicht kritisieren. Feststellen, nicht suchen. Hoffnung haben, unerschütterlich glauben.
Ich stehe am Dnister. Ich kenne den Fluß von der anderen Seite. Ein arabisches Sprichwort sagt: Niemand kühlte je seine Füße im selben Wasser. Mir kommt es freilich die ganze Zeit vor, als wäre ich genau hier über die Kiesel gewatet. Doch nein, die Steine, die damals die kleinen Füße verletzten, sind jetzt anders geschliffen, ihre Berührung wäre den heutigen Füßen fremd.
Ich preise den Dnister, er fließt wie in den fernen Zeiten der Kindheit, ruhig, sicher. Auch wenn er seitdem von österreichischem und russischem Blut getrübt wurde, auch von polnischem. Er ist nicht heiter. Das Wasser ist wie der Mensch, es ist ein Abbild seines Inneren und ebenso ein Spiegel seiner Umgebung. Das Ufer, könnte man sagen, austauschbar, hier rote Felsen, dort noch das frische Grün der Fluren und Wälder. Und so immer abwechselnd, die Ansichten springen von einem Ufer ans andere. Das macht, daß das Flußbett … Nicht schreiben, nicht grübeln, schauen …. Irgendwann kleidet es sich in die passende Form. Nutzt, was in die Tiefen des Unterbewußtseins eindrang.
22. August 1939
Ich fasse einen Eindruck sur la vie … Das warme Podolien erhellt das Geheimnis des ganzen Lebens, mir ist klargeworden, daß ich die Frau des Südens bin, die ich schon immer war, weil ich hier zur Welt gekommen bin. In diesem Land, das gewissermaßen kein Teil Polens, sondern ein eigenes Land ist, spüre ich mein eigentliches Vaterland. Die üppige Flora, ihre Fülle zeugt von einem anderen geographischen Breitengrad. (…)
25. August
Ich muß nicht allein sein, wenn ich nicht will. Ich kenne niemanden, niemand stellt sich hier vor, aber ich plaudere mit verschiedenen Menschen. Gestern haben wir mit der ganzen Gruppe einen Ausflug nach Zaleszczyki gemacht. Fünfzig Beamte der Staatlichen Forstbetriebe sind in Horodnica eingetroffen. Sie machen hier zwei Wochen Urlaub. Die schon anwesenden Männer haben unübersehbar Verstärkung bekommen. Es wird am Strand keine einsamen Frauen mehr geben, Satyrn mit nackten Oberkörpern entführen alle halbwegs jungen Feen. Auf dem Weg durch das unwegsame podolische Gelände wird Pan sie mit der Flöte begleiten. Ich habe das Präludium zu dieser Agape bei der Besichtigung der Weinberge gesehen. (…)
28. August 1939
Wenn ich auch über nichts anderes schreiben will, als was meine Augen sehen, so muß ich doch, als Material für spätere Artikel, meine Eindrücke von der mir zuvor unbekannten Institution festhalten. Obwohl chaotisch, kann ich die Notizen später für ein Stück nutzen, in dem der eine oder andere Aspekt erhellt wird. (…)
In der unpolitischen Atmosphäre vergißt man den Antisemitismus. Niemand denkt an die Möglichkeit eines Kriegs. Das merke ich, während ich höre, was die Leute reden. (…)
[Donnerstag]
Die Staatlichen Forstbetriebe stehen in geschlossener Reihe bereit zum Abmarsch. Es war ein kurzer Urlaub. Die Waldgötzen schauen keine Frau an.
Bei Tagesanbruch brachen sie auf. Ich kehre in die Hütte zurück. Die Bauern teilen die tägliche Arbeit unter sich auf. Alle sind auf den Beinen. Ich kann in Ruhe schreiben. Das Klappern der Schreibmaschine kann niemanden mehr aufwecken. Obwohl es noch nicht ganz fünf ist. Nachmittags mit Irena am Fluß. (…)
1. September 1939
Ich bin mit dem Bleistift in der Hand unterwegs. Der Morgen versammelt podolische Aromen. Es ist so hell, daß man blinzelt. Beim Frühstück ist nur noch ein kleines Grüppchen. Ich werde auf jeden Fall in ein paar Tagen abreisen. Schließlich muß ich auf dem mir zugewiesenen Posten sein. Vielleicht gibt es Krieg … Vorher für einige Tage nach Zaleszczyki. Ich sage das dem Kommandanten und bitte um die Rückgabe der 200 Zloty, die ich ihm zur Aufbewahrung gab. Er rät mir nicht wie gestern sanft von dem Ausflug ab, er bittet mich nicht zu bleiben, sondern gesteht: »Wir haben das Geld genommen.« Sie mußten Bauern, die den Stellungsbefehl erhalten hatten, für frühere Lieferungen bezahlen. Vielleicht hatten sie gedroht? Er verspricht mir, das Geld zurückzugeben, sobald er welches aus der Zentrale erhält. »Bitte warten Sie.« Ich warte. Währenddessen schleiche ich um den »Pavillon«, »ohne Verwendung«, wie wir solche Situationen mit Jasiek früher immer nannten.
Das Radio ist kaputt. Wird es Post geben?
Nachmittag. Ich setzte auf die andere Seite des Dnister über. Bei der Fähre sagt mir eine Frau, sie nehme diesen Weg nach Zaleszczyki, weil die Bahnverbindung durch Rumänien unterbrochen sei. Ängste. Spaziergang durch den Wald mit dem ständigen Gedanken: Immer weiter! Sehen, was hinter der Sichtgrenze ist. Typisch für mich. Und zugleich die Sorge, es könnte schlechte Neuigkeiten geben. Ich kehre zum Fluß zurück. An der Fähre steht eine Britschka. Ein Offizier will übersetzen. Wenig Wasser, die Überfahrt wird dauern. Er hat es eilig. Er befiehlt einem Bauern, der mit einem Sack auf den Schultern wartet, bis er an der Reihe ist, eine Furt zu suchen. Der Bauer widersetzt sich, er sei nicht von hier, er kenne den Dnister nicht. »Von wo dann?!« Der Offizier unterstreicht seine Frage durch das Zischen der Peitsche, die er dem Kutscher abgenommen hat. »Papiere!« In seinem brutalen Verhalten spüre ich den Vorgeschmack des Kriegs. Ich erstarre. Dann wendet er sich an mich: »Was machen Sie hier?« »Ich bin im Ferienlager.« »Es gibt keine Ferienlager mehr. Wir haben Krieg.« Mein Gesichtsausdruck weckt Mitleid in ihm. »Ja«, sagt er sanfter, »wir haben Krieg. Sie haben schon Grodno und Lemberg bombardiert, doch wir sind in Ostpreußen einmarschiert. Die Siegfrieds-Linie ist durchbrochen.«
Wir sind auf der Fähre. Offensichtlich will der Offizier die Beziehungen zur ukrainischen Dorfbevölkerung nicht verschlechtern, er läßt den Bauern seiner Wege ziehen. Jetzt steht er jung und kühn neben mir. Er tröstet mich: »Was soll’s, das alles wird bald vorbei sein.« »Sie haben leicht reden. Sie haben den Großen Krieg nicht erlebt.« »Doch … Als Student bin ich in die polnische Armee in Frankreich eingetreten …"
Plötzlich fühlen wir uns einander nah. Ich strecke meine Hand aus. Er küßt sie. Wir sagen unsere Namen. »Sie haben mir den ersten Frontbericht erstattet … Ich kann Ihnen nicht genug dafür danken.«
Er springt auf die Britschka und verschwindet, wie in einem Roman von Korzeniowski, in einer Staubwolke.
Ich kehre zum Pavillon zurück. Als Überbringerin der furchtbaren Nachricht … Rasch halte ich die Notizen des heutigen Tages, die unvermittelt zum historischen Dokument geworden sind, auf der Schreibmaschine fest.
Abend. Das Radio ist repariert. Es spuckt unverständliche Wortkombinationen aus: »Achtung, Achtung, vorbeigezogen, vorbeigezogen.« Dann fremde Namen, geometrische Formeln, neue Wortschöpfungen. Was hat das zu bedeuten? Jemand erklärt: »Erinnern Sie sich nicht an die Probealarme? So signalisieren sie Luftangriffe.«
Auf Warschau?
[…]
SINN UND FORM 5/2019, S. 640-657, hier S. 640-644
