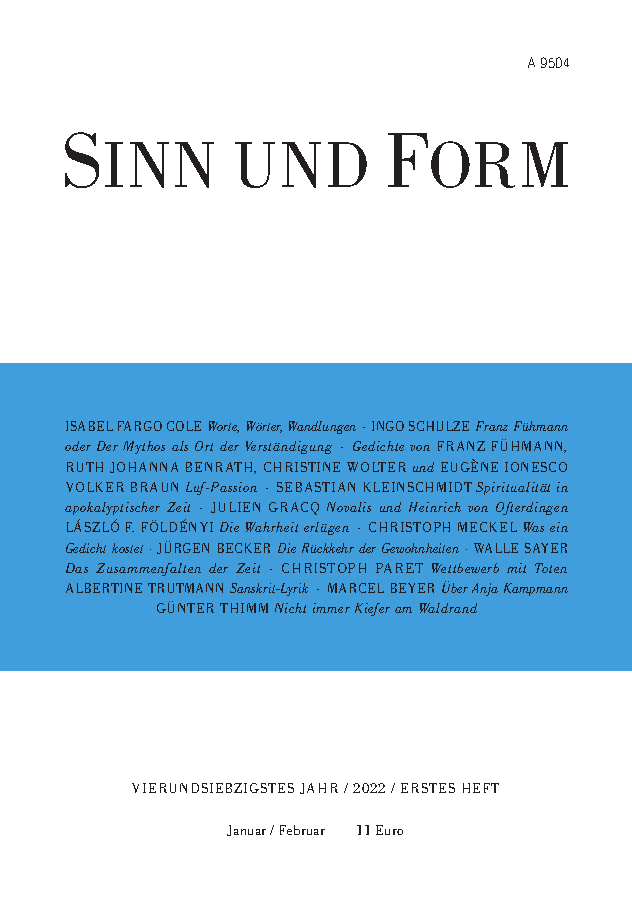
[€ 11.00] ISBN 978-3-943297-63-8
Printausgabe bestellen[€ 8,00]
PDF-Ausgabe kaufenPDF-Download für Abonnenten Sie haben noch kein digitales Abo abgeschlossen?
Mit einem digitalen Abo erhalten Sie Zugriff auf das PDF-Download-Archiv aller Ausgaben von 2019 bis heute.
Digital-Abo • 45 €/Jahr
Mit einem gültigen Print-Abo:
Digital-Zusatzabo • 10 €/Jahr
Leseprobe aus Heft 1/2022
Paret, Christoph
Wettbewerb mit Toten. Über eine eigentümliche Rezeptionstheorie Boris Groys’
Ist es trotz oder wegen der Publikationsflut unserer Tage, daß die Ratgeber, die ich mir eigentlich wünschen würde, partout nicht erscheinen wollen: »Stillschweigen. Wie Sie zu Ihrer eigenen Schreibblockade werden«, »Das leere Blatt – eine Utopie«, »Schreib-Enthemmung? 120 geniale Tips sich zurückzuhalten«. Jedenfalls muß es mittlerweile als Ereignis allerersten Ranges angesehen werden, wenn ein Text einmal nicht geschrieben wird. So erklärt sich die Aufmerksamkeit, die der in Sinn und Form veröffentlichte Briefwechsel zwischen Hans Magnus Enzensberger und Theodor W. Adorno jüngst erfahren hat. Adornos angekündigte Kritik des Godesberger Programms der SPD ist nie erschienen, da mochte Enzensberger als Herausgeber des Kursbuchs noch so sehr drängen, bitten und ermutigen. Der gegenwärtige Herausgeber Armin Nassehi teilte seiner Leserschaft gutgelaunt mit, er habe die Probleme seines Vorgängers nicht. Adorno habe sich auf eine Weise geziert, »die heutigen Autorinnen und Autoren wohl nicht mehr zur Verfügung« stehe. Man gönnt es ihm. Die Autoren von heute lassen sich nicht lange bitten. Kein Potential, das unausgeschöpft bliebe, keine Gelegenheit, die verpaßt würde. Ohne mich hier über die Gründe auslassen zu wollen: Nicht zu schreiben ist ein Luxus, den sich kaum noch jemand leisten kann. Die nachfolgenden Generationen werden es uns hoffentlich danken und über uns sagen, wir hätten alles gegeben, was wir konnten, und dann hätten wir weitergemacht. In Anbetracht des Umstands, daß an Geschriebenem kein Mangel besteht: Gibt es etwas Kostbareres als unterbliebene Schriften, also Momente, in denen einer davon Abstand nahm zu schreiben? Was ließ Adorno zögern?
Der erstaunlichste Hinderungsgrund bekundet sich im Eingeständnis: »Über einem solchen Text liegt der Riesenschatten der ›Kritik des Gothaer Programms‹ von Marx, und ich bitte es nicht als anmaßend zu betrachten, wenn ich hinter diesem Vorbild nicht zurückbleiben möchte.« Hier haben wir sie also, die Schreibhemmung allererster Güte namens Karl Marx!
Was Adorno innehalten ließ, war weniger Rücksichtnahme auf lebende Leser als auf die Schriften eines Toten. Diese Rücksicht scheint uns in der Tat abhanden gekommen zu sein. Wer wollte sich, so Nassehi, »noch als Licht im Schatten von Vorgängertexten stilisieren, die zu übertreffen auch eine negative Dialektik nicht in Frage stellen könne. Solche Sprecherpositionen gibt es aus guten Gründen nicht mehr.« Es gab einmal eine Zeit, in der man die alten Texte nicht nicht überbieten wollen konnte. Wobei die »guten Gründe«, warum es damit nun vorbei ist, von Nassehi nicht ausgeführt werden. Ich bin jedenfalls geneigt, Nassehis Verdikt ein wenig abzumildern: Einer, der sich wie Adorno in einen »Riesenschatten « gestellt sieht, muß sich nicht gleich für die Sonne selbst halten oder sich als »Licht stilisieren«. Besteht nämlich ein alternativer Weg, sich für ein großes Licht zu halten, nicht gerade darin, die Existenz von »Riesenschatten« zu leugnen? Was ist vermessener: das Ansinnen, es mit jemandem wie Marx aufzunehmen, oder aber der Entschluß, ihn zu ignorieren?
Adornos Verlegenheit ist eine doppelte. Gewiß, es ist ihm etwas peinlich, sich dem Vergleich mit einem Marx-Text auszusetzen (»ich bitte es nicht als anmaßend zu betrachten …«), doch diese Betretenheit setzt eine andere voraus: Hier sah sich jemand von einem Text aus der Vergangenheit derart in Verlegenheit gebracht, daß ein eigener Text nicht zustande kam. Was hat es mit dieser Besorgnis auf sich, Ansprüchen nicht gerecht zu werden, die aus der Geschichte in die Gegenwart hineinragen? Und gehören solche Ansprüche nunmehr selbst der Vergangenheit an? Ich kenne keinen Text, der darüber mehr Aufschluß gibt als Boris Groys’ »Politik der Unsterblichkeit. Vier Gespräche mit Thomas Knoeffel« von 2002:
»Als Philosophen oder als Künstler stehen wir vor allem im Wettbewerb mit den Toten. Im Grunde wollen wir, daß Hegel oder Kant uns sagen: Auf diese Idee bin ich nicht gekommen, wie wunderbar hast du das gemacht. Unsere eigentlichen Leser sind die Toten. Auch wenn wir meinen, Platon oder Kant überwunden zu haben – wirklich beseitigen können wir sie nicht. Aber wir können auch nicht von ihnen anerkannt werden, wie wir es uns insgeheim wünschen.«
Damit geht Groys über das hinaus, was die Rezeptionsästhetik als Erklärung des geschichtlichen Lebens literarischer Werke in Anschlag gebracht hat. Kontextualisierende (Kunst-)Theorien stoßen rasch an ihre Grenzen, wenn es um die Frage geht: Warum gehen einen die Texte längst Verstorbener in jedem Sinn des Wortes an? Warum kann uns ein Werk betreffen, »das als bloßer Reflex einer längst überwundenen gesellschaftlichen Entwicklungsform nur noch das Interesse des Historikers verdienen würde«, wie Hans Robert Jauß in »Literaturgeschichte als Provokation« schrieb? Die Antwort auf die Frage, aus welchen Gründen Werke jenseits ihres Entstehungskontexts rezipiert werden, fiel bei der Rezeptionstheorie seltsam zirkulär aus: Sie werden rezipiert, weil sie rezipiert werden. Jauß: »Das literarische Ereignis hat im Unterschied zum politischen nicht für sich weiterbestehende unausweichliche Folgen, denen sich keine nachfolgende Generation mehr entziehen könnte. Es vermag nur weiterzuwirken, wo es bei den Nachkommenden noch oder wieder rezipiert wird – wo sich Leser finden, die sich das vergangene Werk neu aneignen oder Autoren, die es nachahmen, überbieten oder widerlegen wollen.«
Doch warum sollte man ein Werk nachahmen, überbieten und widerlegen wollen, wenn man nicht zunächst im Bann des Eindrucks stünde, daß es von sich aus fortwirkt, ob nun als verpflichtende Instanz, Herausforderung oder verhängnisvoller Irrtum? Jauß’ Fehler ist die Annahme, daß die »Pflege« der Tradition den Lebenden obliege und daß diese augenblicklich verfallen würde, wenn sich nicht jede Generation dazu bereit erklärte, sie sich von neuem anzueignen. Die Vitalität einer Denktradition hängt jedoch weniger davon ab, ob man sie rettet, sondern eher davon, ob man sich vor ihr oder in ihr rettet. Wenn es nämlich Groys’ »Wettbewerb mit den Toten« gibt, dann bedürfen diese weniger des Beistands der Lebenden, als daß die Lebenden vor den Toten bestehen müssen. Ironischerweise hätte die Rezeptionstheorie also den Rezipienten nicht stark genug gewichtet. Sie hätte sich mit der Auskunft begnügt, daß die Meisterwerke gelesen und wiedergelesen würden. Sie hätte nicht zugestehen wollen, daß sie insofern groß sind, als sie uns lesen: Sie sind der eigentliche Rezipient und Adressat unserer Schriften. »Unsere eigentlichen Leser sind die Toten«, schreibt Groys. In Jauß’ Gedanken von der »Aktualisierung literarischer Texte durch den aufnehmenden Leser« bleibt die Möglichkeit der Aktualisierung aktueller Texte durch aufnehmende tote Leser ungedacht.
Demnach bestünde die angemessene Reaktion auf eine Standardfrage wie »Was hat uns Hegel heute noch zu sagen?« nicht darin, sie zu beantworten, sondern zurückzuspielen: »Was hätten Sie Hegel denn zu sagen?« Das Schicksal solcher Texte ist in dem Moment zu ihren Ungunsten entschieden, da sie vor der Gegenwart in der Rechtfertigungspflicht stehen, anstatt daß sich die Gegenwart in ihrem Licht erklären muß. Anders gesagt: Hegel, Kant oder Marx anzuerkennen, impliziert immer schon den Wunsch, von ihnen, oder wenigstens in ihrem Sinne, anerkannt zu werden. Alle »guten Gründe« sind in dem Falle schon die ihrigen, nämlich Gründe, die man ihren Texten entnehmen kann. Wer also fragt, warum er die Texte von Toten ernst nehmen sollte, hat sich bereits darauf festgelegt, daß er nicht gewillt sei, hinsichtlich ihrer ernst genommen zu werden. Das bedeutet nicht, daß die Frage falsch ist, wohl aber, daß sie nicht neutral ist. Und es bedeutet auch, daß es sich gar nicht um eine echte Frage handelt, weil sie die Antwort immer schon in sich trägt. Zudem wäre es viel zu harmlos, sich zu fragen, ob man beim Schrei ben den Schriften der großen Toten Rechnung tragen sollte. Gerade Adorno hat in dem Moment, der uns hier interessiert, gezeigt, daß ihnen Rechnung zu tragen bisweilen auch bedeuten kann, gar nicht zu schreiben.
Die »Relevanz« vergangener Texte für die Gegenwart entscheidet sich nicht an der Frage, inwieweit die Toten recht hatten oder falsch lagen. Wenn sie nämlich relevant sind, dann weil sie nicht aufhören, einem recht zu geben oder weil sie einen weiterhin aufs Glatteis führen. Noch immer muß man sich ihrer Irrtümer erwehren, noch immer ihre Bestätigung einholen. Gewiß ist es problematisch, derartiges zu sagen. Unleugbar tut sich hier eine verdächtige spiritistische Tendenz kund. Dabei ist aber weitaus mehr im Spiel als die Frage, ob jemand ernstlich an die Gespenster namens Kant, Hegel oder Marx glaubt. Es geht darum, ob diese Gespenster an einen selbst glauben.
Die besondere Ironie besteht darin, daß es Groys nicht bloß darum geht, eine »karrieristische « und falsche Form des Philosophierens von einer sachorientierten, wahren zu unterscheiden. Groys ist erklärter Pragmatist, wenn nicht gar Neoliberaler, der in den Begriffen des Wettbewerbs denkt. Würde er den Neoliberalismus für irgend etwas kritisieren, dann allenfalls für das Unlautere eines Wettbewerbs, zu dem allein Lebende Zugang haben, obgleich die Toten recht besehen die stärksten Konkurrenten sein müßten.
Es gibt ein weiteres anti-neoliberales Element: Die Toten, und nicht der »Markt«, sind die letzte Instanz: »Wenn ich von der Pragmatik des philosophischen Erfolgs spreche, dann meine ich damit weniger den Erfolg bei den Lebendigen als den Erfolg bei den Toten.« Wobei diese Pragmatik nicht sonderlich pragmatisch anmutet: Philosophieren soll hier nämlich heißen, die berühmten Toten noch einmal töten zu wollen und rückwirkend ihre Bestätigung einzuholen, und dies im vollen Bewußtsein der Tatsache, daß der eine Wunsch dem anderen widerspricht und beide unerfüllbar sind. Man weiß deshalb nicht recht, ob der Kampf gegen die Toten überflüssig oder aussichtslos ist, »denn auf der einen Seite sind sie, Gott sei Dank, tot, aber auf der anderen Seite gehen sie uns immer weiter auf die Nerven«. Ein solcher Kampf trüge gleichermaßen lächerliche wie heroische Züge. Man fragt sich unwillkürlich: Was wäre das Ziel? Groys’ Antwort: in gewisser Weise selbst tot sein.
»Was ich unter Genuß verstehe, ist die Möglichkeit, nachdem man sein Grab gebaut hat, darin ruhig zu liegen und dieses Grab zu genießen, noch bevor man tot ist. Bei vielen Autoren, die ihre philosophischen Konstruktionen schon gebaut haben, spürt man das Gefühl: Meine Grabstätten sind bereits da, alles bleibt erhalten. Dann tritt eine gewisse Entspannung ein, die Bereitschaft zur ungezwungenen Plauderei – eben ein bißchen angenehmes Leben im Tode.« Das Verhältnis zum eigenen Tod würde ein chiastisches sein: Philosophieren hieße vom Wunsch geleitet sein, nach dem Tode fortzuleben, im Gegenzug jedoch zeit seines Lebens tot zu sein. Man muß das vor dem Hintergrund des grassierenden Biographismus lesen, der glaubt, uns daran erinnern zu müssen, daß die großen Toten ganz normale Menschen mit gewöhnlichen kleinen Leben gewesen seien. Peter Sloterdijk hat in diesem Zusammenhang von der »Liquidierung des alteuropäischen Theoriesubjekts « gesprochen, wodurch »nun auch die theoretischen Menschen wieder wie Leute von nebenan erscheinen, sollten sie auch Albert Einstein, Max Weber, Claude Lévi- Strauss oder Niklas Luhmann heißen«. Ironischerweise bestünde diese Liquidierung darin, den Theoretiker ins pralle Leben zurückzuholen, weshalb Sloterdijk mutmaßen konnte: »Nicht alle Subjekte von Reanimationen begrüßen ihre Rückkehr ins volle Leben, ja, ich hege den Verdacht, sie bedauerten ihre Zurückholung aus dem schönen Tod der Interessenlosigkeit in die Arena der kognitiven Realpolitik.« (»Scheintod im Denken«, 2010)
Mit Groys will ich zweierlei zu bedenken geben: Erstens hätte Philosophie weniger mit dem »schönen Tod der Interessenlosigkeit « zu tun, sondern bedeutet, sich für Tote zu interessieren, wenn nicht gar, sich für Tote interessant zu machen. Zweitens würde die Verwandlung des Theoretikers in einen Normalsterblichen ihn nicht notwendigerweise seines Status als Theoretiker berauben. Vielmehr verwandelt er sich erst dadurch, daß er etwas Definitives geschrieben hat, in einen normalen Menschen, mit dem sich ungezwungen plaudern ließe. Vor diesem Zeitpunkt wird er dagegen ein anstrengender Zeitgenosse sein, der sich seinen Platz erkämpfen muß. Normalität gäbe es nicht vor der Theorie und als deren Quelle; normal und entspannt wäre der Theoretiker erst nach seinem Tod, der ihm in Gestalt der eigenen Konstruktionen entgegentritt. Hier begegnet einem übrigens ein weiterer Grund nicht weiterzuschreiben: Man hält nicht deshalb inne, weil man glaubt, vor gewissen Toten nicht bestehen zu können, sondern weil man glaubt, als Toter selbst Bestand zu haben.
Groys gibt nirgendwo ausdrücklich zu, mit der Erhaltung seiner Grabstätte zu rechnen, hat aber für das Titelbild als Leiche posiert, die mit offenen Augen im Bett liegt, während auf dem Beistelltisch die, wie man es ihm gern wünschen würde, definitiven Papiere liegen. Dazu paßt nicht ganz, daß er am Ende des Gesprächs bestreitet, am Wettbewerb mit Toten teilzunehmen: »Wenn die Philosophie eine Lebensform und ein Wettbewerb ist, dann bedeutet die philosophische, kontemplative Haltung in bezug auf die Philosophie die Nicht-Teilnahme an diesem Wettbewerb. Ich befinde mich viel lieber auf der Zuschauerbühne.« Kontemplativ sein kann man demnach nicht erst, wenn die eigenen Konstruktionen gebaut sind, sondern auch indem man anderen dabei zusieht, wie sie die ihren errichten. Doch wer macht das eigentlich noch?
Wenn Nassehis Behauptung stimmt, daß man mittlerweile davon Abstand nimmt, Vorgängertexte als Bezugspunkte des eigenen Schreibens zu begreifen, würde einem solchen Zuschauer nicht viel geboten. Diese Erfahrung kann man tatsächlich machen: Sobald die Texte der Vergangenheit als mehr oder minder unbeträchtlich gelten, büßen paradoxerweise auch diejenigen der Gegenwart ihre Wirksamkeit ein. Zwar würde sich Nassehi, wie er schreibt, Enzensbergers Satz »verzeihen sie meine ungeduld: es ist aber nicht ein redakteur, der hier drängt, es ist die sache selbst« gern für die eigene Autorenkorrespondenz ausbedingen, zugleich muß er aber eingestehen, »daß sich im Kontakt mit Autorinnen und Autoren heutzutage viel seltener geschichtsphilosophische Wucht oder gar ein Fenster für eine Offenbarung auftut«. Die Sache selber drängt nicht mehr zum Text, sie drängt am Text vorbei. Als hätte man in dem Moment, da man sich der Bürde der Vergangenheit entledigte, nicht nur an Unbefangenheit gewonnen, sondern sich zugleich um alle Relevanz für die Gegenwart gebracht. Ein weiterer Grund, weshalb Adorno den Text über das Godesberger Programm schuldig blieb, bestand darin, daß er beim Verfassen seiner »Negativen Dialektik « ins Stocken geraten war. Ihre Fertigstellung erforderte höchste Konzentration. Die heutigen Autoren des Kursbuchs würden Nassehi zufolge auch deshalb kaum eine Anfrage ausschlagen, weil sie nun einmal nicht damit beschäftigt seien, eine »Negative Dialektik« zu schreiben. Schade eigentlich. Für Groys hatte sich die Situation deshalb schon 2015 ins Gegenteil verkehrt: »Wenn ich früher an meinen Tod dachte, war ein unangenehmer Gedanke immer der, daß, wenn ich sterbe, in der Kultur noch viel geschehen wird. Heute fühle ich mich glücklich, denn die Kultur ist früher gestorben als ich. Also kann ich glücklich sterben in der Überzeugung, daß nach meinem Tod nichts mehr passieren wird, was mich hätte interessieren können.« (Boris Groys, Frank M. Raddatz: »Geld schlägt Wort«, in: Lettre International 2015 / 111)
Im Abstand eines guten Jahrzehnts präsentiert er somit zwei Versionen vom Glück des Theoretikers, die auch zwei unterschiedliche Weisen sind, sich mit der eigenen Sterblichkeit abzufinden: Bei der einen besteht sein Glück darin, sich schon zu Lebzeiten in den Archiven der Kultur begraben fühlen zu können, bei der anderen darin, Zeuge zu werden, wie diese selbst begraben werden.
SINN UND FORM 1/2022, S. 124-128
