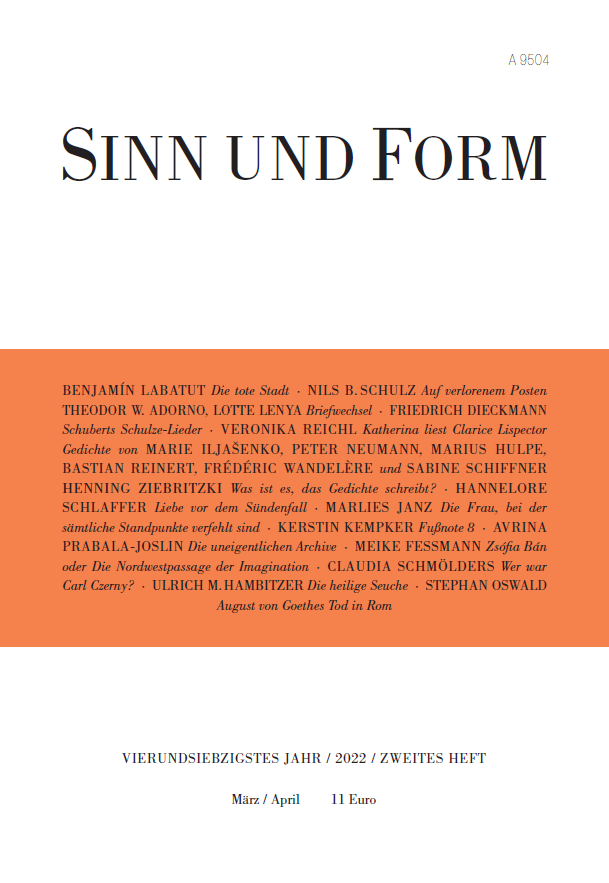
[€ 11.00] ISBN 978-3-943297-64-5
Printausgabe bestellen[€ 8,00]
PDF-Ausgabe kaufenPDF-Download für Abonnenten Sie haben noch kein digitales Abo abgeschlossen?
Mit einem digitalen Abo erhalten Sie Zugriff auf das PDF-Download-Archiv aller Ausgaben von 2019 bis heute.
Digital-Abo • 45 €/Jahr
Mit einem gültigen Print-Abo:
Digital-Zusatzabo • 10 €/Jahr
Leseprobe aus Heft 2/2022
Adorno, Theodor W.
»Ich habe die Hosen voll, wenn ›ich an Deutschland denke in der Nacht‹«. Briefwechsel mit Lotte Lenya. Mit einer Vorbemerkung von Jens Rosteck
Vorbemerkung
Kurt Weills plötzlicher Tod im einundfünfzigsten Lebensjahr, ausgelöst durch einen Herzinfarkt, am 3. April 1950 warf seine Ehefrau Lotte Lenya (ursprünglich Karoline Wilhelmine Charlotte Blamauer, 1898–1981) völlig aus der Bahn. Zweieinhalb stürmische Jahrzehnte hatten sie verbunden, ein bemerkenswertes Auf und Ab in Liebesdingen, eine veritable Schaffensexplosion, eine beispiellose Premierenserie in Berlin, die glorreiche wie mythenumrankte Brecht-Ära, die schwierige Emigration, der Neuanfang in den Vereinigten Staaten und gleich zwei Hochzeiten. Weills letztes amerikanisches Bühnenwerk, »Lost in the Stars«, erlebte am Broadway nicht weniger als 281 Aufführungen und stand auch in seinem Todesjahr – ohne ihre Mitwirkung – noch immer auf dem Spielplan. Nun dämmerte Lenya, die sich von einer außerehelichen Beziehung zur nächsten gehangelt hatte und sich erst allmählich an ihre neue Rolle als »Witwe Weill« gewöhnte, zwischen Apathie und Hoffnungslosigkeit vor sich hin. In ihrem Domizil Brook House in New City vor den Toren New Yorks suchte die einst so Unternehmungslustige, im Grunde eine echte Großstadtpflanze, nach den bangen, schweren Stunden im Flower Hospital eine Zukunftsperspektive.
Untätig herumzusitzen war ihre Sache nie gewesen, die Bühnenkompositionen ihres in den USA zuletzt so populären Mannes Staub ansetzen zu lassen kam ebenfalls nicht in Frage. Doch stand sie, im Showbusineß ihrer Wahlheimat de facto ein Nobody, vor einem unüberwindbaren Dilemma: »Die Amerikaner«, so urteilte sie im Januar 1959 in dem Aufsatz »Kurt Weill’s Universal Appeal«, »hatten seine Musik geliebt, aber kannten nur seine hiesigen Werke, nichts dagegen aus seinen Jugendjahren. Sie wußten nichts von der Art und Weise, wie er die bittere Realität, die Unsicherheit des Deutschlands in den Zwanzigern in seiner Musik einzufangen verstanden hatte.« In der jungen Bundesrepublik wie in der neugegründeten DDR hingegen galten lediglich Weills Werke aus der späten Weimarer Republik etwas, waren seine im Exil entstandenen Musicals und seine Beiträge für eine erst im Entstehen begriffene »American Opera« weitgehend unbekannt, fanden wenig Anklang oder wurden ignoriert, verschmäht oder gar abqualifiziert. »Also entschloß ich mich, wenn auch sehr widerwillig, dort anzufangen.«
Eine doppelte Herkulesaufgabe zeichnete sich ab – den »amerikanischen«, vorgeblich oberflächlichen und regressiven Weill in Europa und den »deutschen«, vorgeblich anspruchsvollen und progressiven Vorkriegs-Weill in der Neuen Welt bekannt zu machen, um seine innovativen Zeitopern, Operetten und Einakter auch bei den nachfolgenden Generationen durchzusetzen. Hinzu kamen die immensen Schwierigkeiten, mit denen Lenya sich als Nachlaßverwalterin konfrontiert sah. Jahraus, jahrein mußte sie sich fortan mit Urheber- und Aufführungsrechten, Partituren, Verlegern, Produzenten, Abrechnungen, Tantiemen, Details von Schallplattenproduktionen und Vertragsstreitigkeiten herumschlagen. Am wichtigsten war freilich, daß sie wieder an Statur gewann: »Zuallererst mußte ich mir selbst einen Namen machen.« Um englischen Zungen die Aussprache zu erleichtern, hatte sie schon 1937 die Schreibweise ihres – an eine Tschechow-Figur angelehnten – Künstlernachnamens (ursprünglich Lenja) abgeändert. Nun wurde aus Lotte Lenya schlicht Lenya, im Big Apple kam sie mit zwei Silben und ohne Vornamen aus. Weitere Markenzeichen waren ihre markante, zusehends dunkler und rauher werdende Stimme und, wie sie ihrem Briefpartner Adorno sogleich mitteilte, ihr neuerdings rotgefärbtes Haar.
Lenyas tiefe Verunsicherung war persönlicher wie künstlerischer Natur und reichte bis in die Kriegsjahre zurück: Im Frühjahr 1945 hatte Weills Operette »The Firebrand of Florence« nach einem Libretto von Ira Gershwin, in der sie als Duchess aufgetreten war, in Boston und New York City teils vernichtende Kritiken bekommen, und das steckte ihr noch in den Knochen. Ihr Selbstbewußtsein als Weill-Interpretin war ins Wanken geraten, sie hatte sich in der Folgezeit von der Bühne zurückgezogen. Während ihr Mann sich im Kollegenkreis durch Fleiß, Kreativität, Erfindungsgabe und eine erstaunliche Assimilierungsbereitschaft rasch Anerkennung verschaffte und auf dem besten Weg war, ein echter Amerikaner zu werden, hatte sie in der Musical- und Showszene der Neuen Welt nie richtig Fuß gefaßt. Ihr Vortragsstil und ihre Gestik, ihr eigenwilliger Sprechgesang, ihre wienerisch-berlinerische Intonation, ihr teils ruppiger, teils lasziver Ausdruck und ihre unvollkommene Beherrschung des (bei ihr stets akzentbehafteten) Englischen entsprachen nicht der Erwartungshaltung der an Entertainment und Wohlklang gewöhnten US-Theatergänger. Alles, was Lenya ausmachte, befremdete sie. Erst später, als die amerikanische Fassung der »Dreigroschenoper« zum Kassenschlager wurde und sie das Musical »Cabaret« mit aus der Taufe hob, stellte sich der Erfolg ein, und sie konnte einen Triumph nach dem anderen feiern. Dann auch wieder als Filmschauspielerin.
Maßgeblichen Anteil an dieser zweiten, internationalen Karriere, die 1961 in einer Oscar- und Golden-Globe-Nominierung sowie 1963 in der Mitwirkung in einem James-Bond-Film gipfelte, hatte ihr nächster Ehemann, der acht Jahre jüngere Romancier und ehemalige Chefredakteur illustrer Zeitschriften (wie »Harper’s Bazaar« und »Mademoiselle«) George Davis (1906 – 57). Dieser vielgereiste frankophile Europakenner hatte schon Carson McCullers und Truman Capote gefördert und sah sich, obwohl vorübergehend mittellos und beruflich desorientiert, imstande, ihrer Bestimmung als authentische Weill-Interpretin Nachdruck zu verleihen.
Lenyas Isolation und Depression endeten rasch, als sie Davis, der sie schon zu Weills Lebzeiten in verschiedene New Yorker Künstlerkreise eingeführt hatte, im Mai 1950 wiederbegegnete. Seinerzeit hatte er zur legendären und auch experimentellen Wohngemeinschaft in der Brooklyner Middagh Street, dem sogenannten February house, gehört, wo sich Berühmtheiten, Bohemiens und Avantgarde-Figuren wie Benjamin Britten und Peter Pears, Jane und Paul Bowles, Christopher Isherwood, W. H. Auden oder die Thomas-Mann-Kinder Klaus und Erika die Klinke in die Hand gaben. Nun wurde der homosexuelle Davis zu Lenyas ständigem Begleiter und zum zweiten von insgesamt vier Gatten. Das Verhältnis war keineswegs frei von Konflikten, doch mit seiner Hilfe und Begeisterungsfähigkeit vermochte sie den Kopf wieder aus dem Sand zu ziehen. Diese »neue Lenya« war ganz und gar seine Schöpfung. Beide boten alle Kräfte auf, um für Weills genuines Konzept eines zeitgenössischen Musiktheaters jenseits von U- oder E-Kategorien zu kämpfen, es am Leben zu erhalten und ihm ein neues Publikum zu erschließen.
Auf die Eheschließung im Juli 1951, ein zaghaftes Comeback im Sprechtheater und einige Hommage-Konzerte für Weill in der New Yorker Concert Hall folgte die sensationell erfolgreiche Off-Broadway-Produktion der »Threepenny Opera« in einer Fassung von Marc Blitzstein. Sie kam, ab März 1954, auf die Rekordzahl von 2 600 Vorstellungen und brachte Lenya einen Tony Award ein. Das war weit mehr als eine Ehrenrettung für den in Amerika verkannten »Berliner« Weill, und dabei ging das Tandem, was dessen Ästhetik betrifft, keine kommerziellen Kompromisse ein und verwahrte sich gegen leichtfertige Vereinfachungen oder ästhetische Zugeständnisse: Im Frühjahr 1955, fünf Jahre nach seinem Tod, setzte Lenya in Begleitung von Davis erstmals seit 1934 wieder ihren Fuß auf deutschen Boden (und zwar auf beiden Seiten der Grenze), spielte maßgebliche Soloalben ein und überwachte mit ihrer historischen Kompetenz die Produktion weiterer Brecht-Weill-Stücke. In Düsseldorf kam 1955 Weills Musical »Street Scene« als westdeutsche Erstaufführung heraus, an der Städtischen Oper Berlin 1957 seine frühe Oper »Die Bürgschaft«. Mit dem Dirigenten Wilhelm Brückner-Rüggeberg wirkte sie in maßstabsetzenden Gesamtaufnahmen von »Mahagonny« und »Die sieben Todsünden« mit, in den Vereinigten Staaten spielte sie unter Maurice Levine »American Theatre Songs« ein. Zusätzlich beaufsichtigte sie dort die Schallplattenpremiere von »Johnny Johnson«. Auf diese Weise etablierten Davis und Lenya geradezu vorbildlich eine authentische und stimmige Weill-Interpretation, die auch für die folgenden Jahrzehnte verbindlich blieb. Ein Glücksfall.
Vor diesem Hintergrund setzt zum Jahresende 1956 der Briefwechsel mit Theodor W. Adorno ein, der sich über das gesamte Jahr 1957 – den Höhepunkt ihrer Bemühungen um Weills musikalisches Erbe in Deutschland – erstreckt und dann erst wieder im Februar 1960 eine Fortsetzung findet. Die Bekanntschaft der beiden geht auf das Berlin der späten Zwanziger zurück, wie eine handschriftliche Widmung der jungen Lenja (sic!) für »Th. Wiesengrund-Adorno« vom September 1929 auf einem Druckexemplar von Marieluise Fleißers Drama »Pioniere in Ingolstadt« belegt. Sie spielte damals in Brechts umstrittener Inszenierung im Theater am Schiffbauerdamm an der Seite von Peter Lorre und Hilde Körber die Rolle der Alma. »Eine Liebe muß keine dabei sein« – das von Lenja für die Widmung ausgewählte Zitat stammt aus Fleißers Stück.
In den Briefen von 1957 – Lenya und Davis pendeln damals zwischen Deutschland und den USA hin und her – ist viel von Weills Brecht-Vertonungen die Rede, den »Sieben Todsünden«, »Happy End«, der »Dreigroschenoper« und den verschiedenen »Mahagonny«-Fassungen. Zum einen, weil sie zu Adornos bevorzugten Weill-Bühnenwerken zählten, zum anderen, weil Lenya sie just in jenem Jahr einspielte, Songs daraus vortrug oder Pläne für Neuinszenierungen schmiedete. Der Leser begegnet in diesem anregenden Austausch, durchweg in liebevoll-zärtlichem Ton gehalten, gespickt mit geistreichen Aperçus und stellenweise auch mit englischsprachigen Einsprengseln versehen, prominenten Zeitgenossen wie den Tänzerinnen und Choreographinnen Irene Mann und Tatjana Gsovsky, den Regisseuren Harry Buckwitz, Heinz Tietjen und Hans Curjel, der Schauspielerin Hannelore Schroth und einer Dame namens »Helli«, der Brecht-Witwe Helene Weigel also, über deren Gier nach Tantiemen ausgiebig gelästert wird und an deren Unnachgiebigkeit so manches von Lenya und Davis angestoßene Projekt zu scheitern droht. Brechts Tod liegt ja noch nicht lange zurück.
Lenya ist merklich daran gelegen, daß Davis bei »Teddy« bzw. »Teddie« und Gretel einen guten Eindruck hinterläßt – ein Wunsch, der in Erfüllung geht –, und äußert mehrfach ihre Besorgnis um seine Gesundheit. Mehrere Herzattacken und -infarkte in immer kürzeren Abständen sind Vorboten seines Todes am 25. November 1957 in Berlin – zwei Wochen nur, nachdem sie im Westteil der Stadt mit der prestigereichen Friedensglocke ausgezeichnet wurde und nur wenige Wochen, bevor sie die »Dreigroschenoper« einspielt. Eine weitere Aufnahme, für die sie bereits den Vertrag unterzeichnet hat, »Das Berliner Requiem«, wird in Anbetracht der Umstände fallengelassen. Davis ist bei seinem Ableben nur unwesentlich älter als seinerzeit Weill, und Lenya erlebt es als Schock und Katastrophe, zumal die gleiche Todesursache vorliegt. Sie resümiert (1962 in der Theaterzeitschrift »Playbill«): »Mein Herz war gebrochen, aber noch viel schlimmer als damals, als es Kurt zugestoßen war. In diesen sechs Jahren unserer Ehe hatte George mich laufen gelehrt, so wie man es einem kleinen Kind beibringt.« Im vorliegenden Briefwechsel mit Adorno findet Davis’ Tod keine Erwähnung, da Lenya das letzte Schreiben vor der mehrjährigen Pause zweieinhalb Wochen vorher verfaßte. Wieder einmal geht es um eine im letzten Moment nicht zustande gekommene Begegnung: »Schade, daß ich nicht ein paar Tage in Frankfurt bleiben konnte. Aber ich lasse George sehr ungern allein mit seiner Furcht vor dem Alleinsein, das typisch für herzkranke Menschen zu sein scheint. So konnte ich also nur schnell noch Gretel anrufen zwischen Zug und Flugzeug.«
Daß Adorno und Lenya auf solch warmherzige, ja fürsorgliche Weise miteinander kommunizieren und auch in künstlerischer Hinsicht völlig übereinzustimmen scheinen, nimmt, gelinde gesagt, wunder: Im Briefwechsel der Eheleute Weill / Lenya trat nämlich, insbesondere in den frühen vierziger Jahren, ein ganz anderes, negatives Adorno-Bild zutage. Dort firmierte der jetzt so Verehrte als »der Wiesengrund« und wurde mit wenig schmeichelhaften, ja beleidigenden Attributen belegt. Hintergrund war vor allem eine Intervention Adornos im März 1942 zugunsten Brechts, dem eine Neubearbeitung der »Dreigroschenoper« mit exklusiv schwarzer Besetzung in Los Angeles vorschwebte. Weill, dessen Ehrgeiz längst dem amerikanischen Musiktheater galt und dem die Angelegenheit »zum Hals heraushing«, hielt jedoch nichts von Wiederbelebungsversuchen der vermeintlich goldenen Berliner Zeit. Er fürchtete um sein Mitspracherecht und witterte ästhetische Verfälschung, erregte sich in einem auf englisch verfaßten Antwortschreiben über Adornos pauschale Abqualifizierung des Niveaus zeitgenössischer Broadwayproduktionen und sprach ihm jegliches Urteilsvermögen in der Angelegenheit ab. Tags darauf, am 8. April 1942, informierte er Lenya per Brief: »Nun, dem Wiesengrund habe ich einen Brief geschrieben, den er lange Zeit nicht vergessen wird. Ich schrieb ihm: es ist eine Schande, daß ein Mann von seiner Intelligenz so falsch informiert sein soll. Und dann erklärte ich ihm, daß das amerikanische Theater nicht so schlecht ist wie er denkt.« Lenya, die gerade in Atlanta mit Maxwell Andersons Stück »Candle in the Wind« auf Tournee war, erwiderte am 9. April: »Eigentlich zu komisch, um sich darüber aufzuregen. Ich bin so froh, daß Du ihm den richtigen Brief über das amerikanische Theater geschrieben hast. Aber bitte Darling, bestehe darauf, daß sie das außerhalb von Hollywood nicht zeigen dürfen. Gib bloß nicht nach. Zum Teufel mit denen.« Lenya warnte ihn, daß Brecht mit Adornos Schützenhilfe »die Musik in Fetzen schneiden« und das Werk »billig und lächerlich machen« würde. Weill hatte es geärgert, daß Adorno als erklärter Jazzfeind und Verfechter absoluter Musik für Brecht Partei ergriff. Von »Fachleuten «, die sogenannte Unterhaltungsmusik als »dekadent« verunglimpften, habe er keine Belehrungen nötig, wie »wichtig« und »wertvoll« seine »Dreigroschenoper« sei. Die Eheleute zogen in dieser Hinsicht also an einem Strang. Dabei hatte Adorno einlenkend noch um Nachsicht mit einem alten Weggefährten gebeten und den Beweis antreten wollen, daß er in der Zeit seines »Schweigens musiksoziologisch noch nicht ganz vertrottelt« sei. Vergebens.
Für Weill stand seit 1931 fest, daß Adorno einen Großteil seiner Musik ablehnte und ihr die Avantgarde-Tauglichkeit absprach, daher erblickte er in ihm einen ideologischen Gegner seines Schaffens. Der Eindruck verfestigte sich noch mit der Publikation von Adornos »Philosophie der neuen Musik« (1949): In der Dichotomie zwischen dem Neoklassizismus Strawinskyscher Provenienz und der zum Ideal erhobenen Zweiten Wiener Schule Schönbergs war für einen dritten Weg, wie ihn Weill beschritt, kein Raum. David Drew, der Doyen der Weill-Forschung, konstatierte 1975, Adornos Abkehr von seiner Musik habe »lange vorher stattgefunden, nämlich zu einer Zeit, als sie beide noch in Deutschland lebten«. Während er über die »Dreigroschenoper« und »Mahagonny« noch Aufsätze publizierte, schwieg er sich über Weills späteres Werk aus. Drew urteilt: »Weill war ohne Reue als Broadwaykomponist gestorben und als solcher in der amerikanischen Presse geehrt und betrauert worden«, Adorno hingegen habe die »zersetzenden und explosiven Elemente« in Weills Brecht-Phase zum Maß aller Dinge erhoben, sei davon nicht mehr abgerückt und habe ihr Fehlen als Manko empfunden, ohne den veränderten Gesetzmäßigkeiten der in den USA entstandenen Kompositionen Rechnung zu tragen.
Von Ressentiments findet sich in der Korrespondenz zwischen Lenya und Adorno keine Spur, wobei man fragen kann, inwieweit letzterer überhaupt Kenntnis von der früheren Verachtung für seine Person und Haltung hatte. Letztlich trug aber auch Lenya durch ihre meisterhafte, ja prototypische Interpretation weiblicher Figuren aus den Weill-Brecht-Werken (Prostituierte, Halbweltdame, Rächerin, burleske Verführerin) zur Verengung der Rezeption auf jene Phase bei. Im September 1955 nahm sie die Moritat von Mackie Messer, den Weill-Hit schlechthin, in einer Dixieland-Fassung mit Louis Armstrong auf; der in der USA geschätzte »September Song« oder die melancholische Ballade »Speak Low« erreichten nie dieselbe Durchschlagskraft – denn sie erfüllten ja auch kein Klischee. Es ging viel Zeit ins Land, bis Weills amerikanischen Opern, Operetten und Musicals (deren Frauengestalten Lenya eben nicht automatisch auf den Leib geschneidert waren) ein vergleichbarer Rang eingeräumt wurde und auch seine übrigen Werke seit den frühen zwanziger Jahren wieder die Spielpläne erobern konnten. Mittlerweile ist eine gewisse Balance in der Beurteilung des »Berliner«, »Pariser« und »New Yorker« Stils zu beobachten, hat sich die Auffassung einer annähernden Gleichwertigkeit der unterschiedlichen Schaffensphasen durchgesetzt.
In den verbleibenden drei Briefen vom Februar 1960 werden andere Sachverhalte erörtert. Lenya möchte eine Verbindung zum Suhrkamp Verlag herstellen und bittet ihren deutschen Freund um Hilfe, sie setzt sich für David Drew ein und denkt darüber nach, eine autobiographische Skizze zu schreiben. Zur Sprache kommt auch ihre Beteiligung an einem Konzert der Musica-viva-Reihe in München unter der Ägide von Karl Amadeus Hartmann. Freunde des frühen Weill können sich im April 1960 darüber freuen, daß bei einer mehrteiligen Produktion an den Städtischen Bühnen Frankfurt neben den »Sieben Todsünden«, in denen Lenya die Anna I verkörpert, zwei seiner Kurzopern mit auf dem Programm stehen, die Einakter »Der Protagonist« und »Der Zar läßt sich photographieren « (beide auf Libretti von Georg Kaiser).
Lediglich am Rande thematisiert wird in der Korrespondenz ein Gespräch, das die Briefpartner im selben Jahr dem Journalisten und Musil-Herausgeber Adolf Frisé für den Hessischen Rundfunk gewährten. Naturgemäß gilt beider Augenmerk wieder den berühmt-berüchtigten zwanziger Jahren und ihrem Hauptschauplatz Berlin – 1960 schon ein Mythos. Während Adorno sich über »Legenden und Ärgernisse« jener an Widersprüchen so reichen Epoche ergeht, spürt man bei praktisch jeder Verlautbarung Lenyas ihre Unbekümmertheit, ihre Nonchalance und ihre Weigerung, die Dinge zu verklären, sowie ihre Freude, zu diesem Mythos beigetragen zu haben, ohne sich dessen nur ansatzweise bewußt gewesen zu sein. Es lohnt sich (besonders nach Lektüre des Briefwechsels), dieses lebhafte, knapp einstündige Doppelinterview wieder anzuhören, und sei es nur, um sich vom unnachahmlichen Klang der Stimme Lenyas betören und von Adornos leichtfüßiger Eloquenz beeindrucken zu lassen.
Jens Rosteck
(…)
SINN UND FORM 2/2022, S. 180-194, hier S. 180-185
