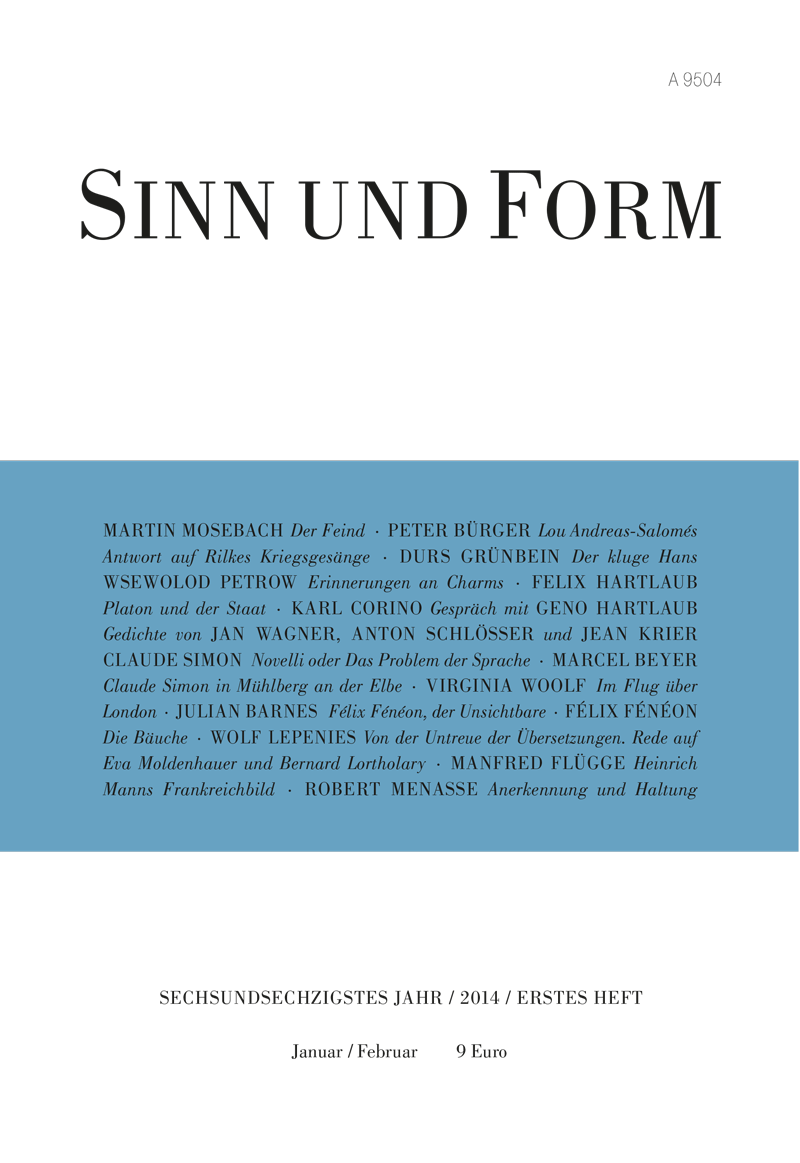Heft 1/2014 enthält:
Mosebach, Martin
Der Feind, S. 5
Ein junger Autor fragte einmal Ernst Jünger um Rat; er plane einen Essay mit dem Thema »Die Insel« – Jünger riet ab, das Thema sei nicht in den (...)
Bürger, Peter
Die Lust am gemeinsamen Erkennen. Lou Andreas-Salomés Antwort auf Rilkes Kriegsgesänge, S. 21
Grünbein, Durs
Der kluge Hans, S. 28
Petrow, Wsewolod
Erinnerungen an Charms. Mit einer Vorbemerkung von Oleg Jurjew, S. 36
Hartlaub, Felix
Platon und der Staat. Mit einer Vorbemerkung von Karl Corino, S. 48
Vorbemerkung von Karl Corino Centenarfeiern für einen poeta absconditus wie Felix Hartlaub, der im Juni 2013 hundert geworden wäre, mögen in (...)
Hartlaub, Geno
»Felix war ein Meister der Tarnung«. Gespräch mit Karl Corino (1986), S. 63
Wagner, Jan
Nach Canaletto, S. 74
Schlösser, Anton
Der alte Maler in seinem Haus. Gedichte, S. 77
Krier, Jean
Die Bilder, die niemand hört. Gedichte, S. 79
Simon, Claude
Novelli oder Das Problem der Sprache. Mit einer Vorbemerkung von Irene Albers, S. 82
Vorbemerkung von Irene Albers Was Claude Simon von anderen Autoren des Nouveau Roman unterscheidet, wird in kaum einem Text so deutlich wie in (...)
Beyer, Marcel
Blatt, Baracke, Borke, Bordell. Claude Simon in Mühlberg an der Elbe, S. 91
Woolf, Virginia
Im Flug über London, S. 101
Fünfzig oder sechzig Aeroplane waren in der Flugzeughalle versammelt wie ein Schwarm Grashüpfer. Der Grashüpfer hat die gleichen riesigen (...)
Barnes, Julian
Hinter der Glaslaterne. Félix Fénéon, der Unsichtbare, S. 107
Fénéon, Félix
Die Bäuche, S. 117
Lepenies, Wolf
Von der notwendigen Untreue der Übersetzungen. Laudatio auf Eva Moldenhauer und Bernd Lortholary, S. 125
Flügge, Manfred
Ein unverlierbarer Traum. Heinrich Manns Frankreichbild, S. 129
Menasse, Robert
Anerkennung und Haltung. Dankrede zum Heinrich-Mann-Preis 2013, S. 132