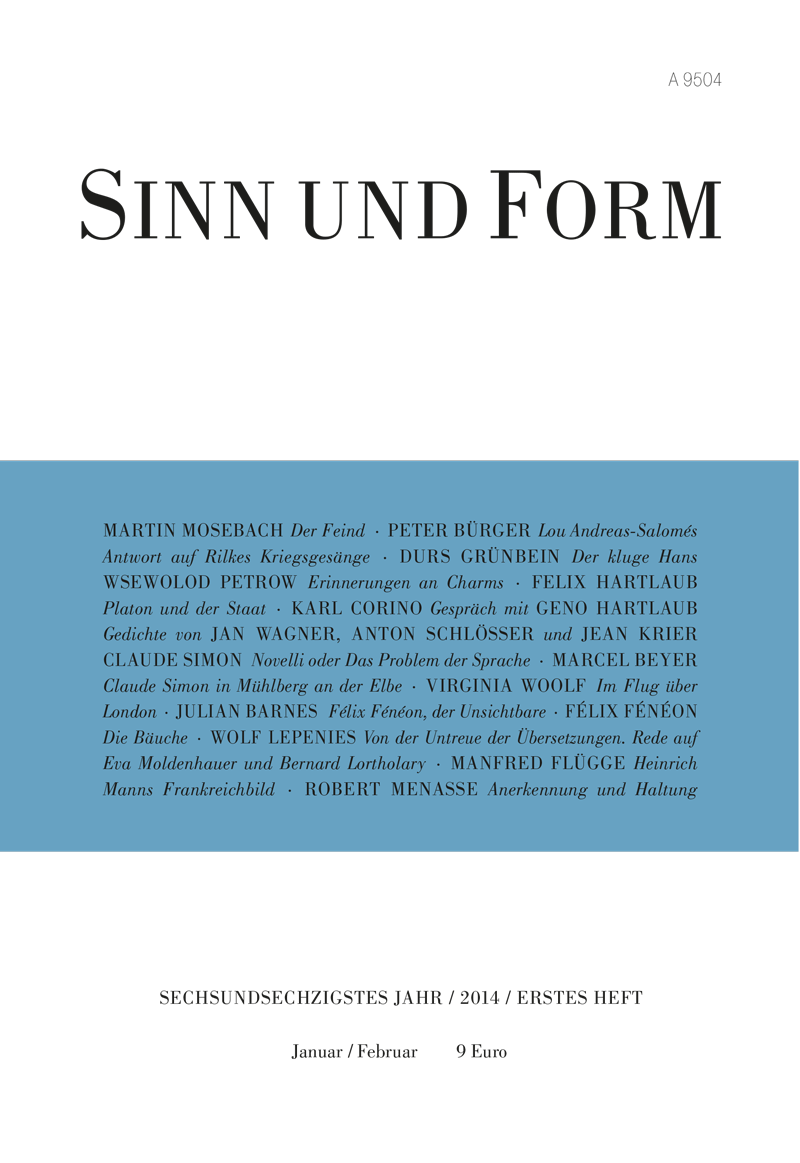Leseprobe aus Heft 1/2014
Mosebach, Martin
Der Feind
Ein junger Autor fragte einmal Ernst Jünger um Rat; er plane einen Essay mit dem Thema »Die Insel« – Jünger riet ab, das Thema sei nicht in den Griff zu bekommen, es sei zu groß. Für einen Aufsatz über den Feind müßte dasselbe gelten, schon gar in einer Kultur, in deren Grundfesten ein Bewußtsein von ewiger, unüberwindlicher Feindschaft eingemauert ist: der Glaube an den Satan, den Menschenmörder und Menschenfeind schlechthin. Große mythische Erzählungen berichten von seinem Aufstand gegen Gott, von der Eifersucht eines der ersten unter den Engeln, von seinem Sturz aus dem Himmel in die Bereiche, die von da an die Hölle sind, das Reich des Bösen. Er ist Fürst dieser Welt, Gott läßt ihn hier schalten und walten, und zugleich ist er schon gerichtet; während des Weltenlaufs darf er sich über immer neue Etappensiege freuen und hat aufs ganze gesehen doch schon jetzt verloren. Wie es einem Dämon entspricht, hat er viele Gesichter: Man kennt ihn als dummen und als armen Teufel, als schönen und als häßlichen, als Fratze und als Titan. Nur eines steht fest: Mit diesem Person gewordenen Mysterium iniquitatis gibt es keine Verhandlungen und keine Kompromisse, keinen Waffenstillstand und schon gar keinen Frieden. Und zugleich ist er notwendig – so wie es Gott gefallen hat, die Welt einzurichten, war ohne den Teufel nicht auszukommen. Der Teufel garantiert die Freiheit der Menschen, sich gegen Gott zu entscheiden, und an dieser Freiheit scheint dem Schöpfer alles gelegen. Und umgekehrt: Der Herr wünscht offenbar, daß sein menschliches Ebenbild angesichts des scheinbaren Sieges des bösen Feindes, im Eindruck der Übermacht des Bösen und der Vergeblichkeit, dagegen zu kämpfen, dennoch das Gute und damit Ihn wählt. Die christliche Religion spricht in vielfacher Weise vom Frieden, aber sie ist eine Religion des Kampfes; sie begreift die Welt als Kampfplatz und verleiht denen die Palme, die auf Erden diesen Kampf mit ihrem Leben bezahlen.
Carl Schmitt hat sich besonders mit dem eigentümlichen Prozeß beschäftigt, in dem sich theologische Begriffe und Auffassungen in den letzten dreihundert Jahren säkularisierten; mit der Krise des Glaubens verschwanden die theologischen Denkmuster nicht einfach, sondern wanderten ins Politische ab. Eine der gefährlichsten dieser Transformationen erlebte der böse Feind. An den Dämon, den Versucher, den aufständischen Engel wollte man nicht mehr glauben, dafür entdeckte man ihn nun unter den Menschen. Zum Satan erklärt wird der Feind, der nicht einfach besiegt, sondern ausgerottet werden muß. Es war ohnehin alarmierend, daß der Begriff der Feindschaft in der politischen Theorie eine Rolle spielen sollte, denn politisch sind solche Festlegungen eigentlich gerade nicht. Politisch ist das Offenhalten aller erdenklichen Optionen, im Feind von heute den Verbündeten von morgen, im Verbündeten von heute den künftigen Feind zu sehen. Die englische Devise sagt es am knappsten: »England hat keine Freunde und keine Feinde. England hat Interessen«, was bekanntlich nicht pazifistisch gemeint ist. Politik ist ein Schachspiel, bei dem die geschlagenen Figuren meist auf dem Brett bleiben; Siege sind anstrengend, Niederlagen nicht aussichtslos – wer wüßte das besser als die Deutschen. Und doch hat auch in jüngster Vergangenheit noch der Begriff einer »Achse des Bösen« eine unheilvolle Rolle spielen dürfen. Nur das militärische und wirtschaftliche Scheitern hat die Verkündung der bedingungslosen Feindschaft verhindert, schmähliche Blamagen haben die Rückkehr zu einer maßvolleren Sprache erzwungen, wer weiß wie lange. Denn die Rede von der totalen Feindschaft ist ja eben nicht nur eine Entgleisung politischer Abenteurer, sie gehört zu den Gesetzmäßigkeiten einer vom Geist der Säkularisation bestimmten Öffentlichkeit. Ächten, An-den-Pranger-Stellen, Teeren und Federn, öffentliche Hinrichtungen gehörten seit jeher zur Domäne der Massen, deren Eintritt in die Geschichte dies Gesetz bestätigt hat.
Aus dem Riesenkomplex der »Feindschaft« möchte ich auf höchst impressionistische Weise einzelne Bilder herausgreifen, wie es sich für mich gehört als Erzähler, dem alle Theorie fremd ist, wenn sie nicht theoria – Anschauung – wird. Und ich möchte dabei vor allem Zusammenhänge betrachten, in denen Feindschaft fruchtbar war. Als Europäer stammt man von einem Kontinent, der seine spezifische, in der ganzen Welt unübertroffene Vielgestalt der Feindschaft unter seinen Völkern verdankt. Die europäische Geschichte bietet ein Schauspiel ohnegleichen. An ihrem Anfang steht das Römische Reich, das viel mehr als ein zusammengerafftes Imperium war. Goethe hat es in den »Zahmen Xenien« in einem Kurzdialog auf den Punkt gebracht: »Jesus: Und unser Pakt, er gilt für alle Zeit? / Rom: Jetzt heiß ich Rom, dann heiß ich Menschlichkeit. « Das war die Verwandlung eines Staates in ein zivilisatorisch-religiöses, in ein nationenübergreifendes Ideal, das bestehen blieb, als das Reich zerfiel. Ob es wirklich aufhörte zu bestehen, war übrigens bis zum Ende des achtzehnten Jahrhunderts umstritten. Aber dies war nicht die einzige Verwandlung. Wie in einer Kelter wurde die Substanz dieses Großreichs zerstampft und dann einer Gärung unterzogen. So entstand der köstliche Wein der europäischen Nationen. Was diese Völker aber auszeichnete, war, daß sie sich allesamt als legitime Erben Roms betrachteten und andern diese Erbschaft eifersüchtig absprachen. Rom lebte in vielen Töchtern weiter – nicht nur in der römischen Kirche mit dem Papst, der die Stelle des römischen Kaisers einnahm und Anspruch auf die Universalität seiner Herrschaft erhob, sondern auch in Deutschland mit seiner translatio imperii, in Frankreich, dessen König kaiserliche Würde behauptete (noch Joseph II. konnte mit seinem Schwager Ludwig XVI. nicht öffentlich zusammentreffen, weil die Frage des Vortritts nicht geklärt war), und in England, dessen Herrscher Heinrich VIII. erklärte: In England ist der König Kaiser. Alle diese Ansprüche bestanden durchaus zu Recht und lösten einen Wettstreit aus, der oft blutig, oft zerstörerisch bis zum Selbstmord war, der aber zugleich die Eigentümlichkeit der Volkscharaktere zu skulpturaler Deutlichkeit steigerte. Es kam schließlich zur Überspitzung des Nationalen, das sich mit dem imperialen Prinzip verband. Im neunzehnten Jahrhundert war fast jede europäische Nation ein Kaiserreich: England, Deutschland, die Donaumonarchie, Rußland, Frankreich, den türkischen Kaiser zu Stambul nicht zu vergessen, Portugal mit Brasilien – im zwanzigsten gelangte selbst Italien noch kurzzeitig zu einer Kaiserkrone. Jetzt schlug die agonale Tradition in Selbstvernichtung um, wie sie das einst auch im antiken Griechenland getan hatte – aber sprach das in allen Epochen gegen sie? Nachdem sich von Deutschland aus ein Kreis von Catilinariern aus der europäischen Konkursmasse ein Verbrecherreich erobert hatte, wurde der Agon geächtet, begreiflich genug, es war auch keine Kraft mehr da. Ein post-histoire gibt es freilich nicht. Die Zeit, die keine nationalen Interessen mehr kennen wollte, scheint an ihr Ende gelangt zu sein, nur daß der neue Nationalismus sich nicht mehr aus gewaltigen historischen Träumen speist, sondern ohne auf Vergangenheit und Zukunft zu blicken an Wagenburgen für eine Notgemeinschaft baut. Prophezeiungen für die weitere Entwicklung werde ich mir versagen. Statt dessen richte ich den Blick zurück, denn die Vergangenheit ist die Utopie des Romantikers.
Die Feindschaft der Brahmanen
Der Nachfahre der Herrscher eines kleinen indischen Königreiches, das seit 1947 im Bundesstaat Rajastan aufgegangen ist, führte mich durch sein Staatsarchiv. Auf vielen Regalen lagen Aktenstapel, die in großzügig verknotete Baumwolltücher eingeschlagen waren. Die Einnahmen und Ausgaben des Staates, die Kosten für die Armee, die Gerichtsurteile, die Aufwendungen für die Hofhaltung bis hin zum Schmuck der Frauen des fürstlichen Harems sowie das Futter für die Elefanten waren hier dokumentiert, in Kalligraphien, die jede Seite der Buchführung zum Kunstwerk machten. Nur eines ließ mich stutzen: Die Herrscherfamilie führte ihren Ursprung auf den Mond zurück, auf unvordenkliche Zeiten also, die ältesten Dokumente des Archivs reichten hingegen nur bis ins frühe neunzehnte Jahrhundert, bis zum Eintreffen der Engländer also, die durch ihren Agenten die Außenpolitik des Königreichs zu lenken begannen. Was mit den älteren Teilen des Archivs geschehen sei? »In den Jahrhunderten vor der indirekten Herrschaft der Engländer haben wir uns unablässig im Krieg mit unseren Nachbarn befunden«, sagte der Maharaj Kumar. Alle paar Jahre sei alles zerstört worden. Die Kriege hatten die Vergangenheit abgeschafft und für ein andauerndes Jetzt gesorgt. Dabei wurden sie keineswegs als Unglück empfunden – hier gab es keinen Raum für Klagen à la »Wir sind doch nunmehr gantz / ja mehr den gantz verheret!«, keinen bitteren Blick auf die unerhörten Verluste à la »Das hat der Feind getan!« Wechselseitige Zerstörung, Belagerung, Überfälle, Beutezüge hatten zum Lebensrhythmus dieser Reiche gehört, die Fürsten nahmen einen Krieg wie die Fortsetzung einer Tigerjagd, die ja gleichfalls nicht völlig ungefährlich war. Die Rajputen, die Kaste, der die Fürsten angehörten, waren für den Krieg geschaffen, so wie die Vaishas für den Handel und die Shudras für die Feldarbeit.
Gewisse Gesten aus dieser Vergangenheit lebten noch in den Gewohnheiten des Maharaj Kumar: Nachdem er mir die meisterlich geschmiedete Klinge seines Säbels gezeigt hatte, fügte er sich damit einen kleinen Schnitt auf dem Handrücken zu – »Ein gezogener Säbel darf erst wieder in die Scheide gesteckt werden, nachdem er Blut geschmeckt hat«. Zum Rajputen Dharma gehörte das Töten; sie erfüllten ein ihnen innewohnendes Gesetz, wenn sie zu Felde zogen. Erst als die erzwungene Pax britannica begann, stieg aus der Stille der verwaisten Schlachtfelder die Geschichte empor. Der erste englische Resident, der legendäre Colonel Tod, sammelte, was es an Überlieferung noch gab, in seinem Werk »Annals and Antiquities of Rajastan«, das zu den großen Historienbüchern des neunzehnten Jahrhunderts gehört, und gab den in unwirklichen Frieden gesunkenen Kriegern ihre Vergangenheit zurück, die in bunter Einförmigkeit eine nicht abreißende Folge von Kämpfen gewesen war. Fruchtbar wird man diese Jahrhunderte nur mit Einschränkung nennen dürfen, aber der Frieden war gleichfalls wenig fruchtbar. Aus den Hauptstädten streitsüchtiger Königreiche wurden graue, armselige Provinzstädte.
Mehr noch als in Tods Geschichtswerk wurde die Vergangenheit mir aber durch ein dickes, aus dem Leim gegangenes Buch aus der königlichen Bibliothek lebendig. Auf meinem Nachttisch lag eine der großen brahmanischen Enzyklopädien, die im ersten nachchristlichen Jahrtausend zusammengetragen worden sind, vor den muslimischen Eroberungen also, als die Kriege noch nicht religiös motiviert waren und die Aggression noch reine, man möchte sagen, begründungsunabhängige Grundfigur der Reiche war. Mein Purana war das Agnipurana, in den zwanziger Jahren ins Englische übersetzt, ein Fürstenspiegel, ein Ritenkompendium, eine Rhetorikschule, eine Lehre der Götter und der Sterne, des Hausbaus und der Behandlung der Frauen, aber eben auch ein Lehrbuch über Feindschaft und Krieg. Im zweihundertvierzigsten Kapitel wird dem König geraten, stets einen Kreis von zwölf ihn umgebenden Königen im Auge zu behalten: den Feind, den Freund, den Verbündeten des Feindes, den Verbündeten des eigenen Verbündeten, den Verbündeten eines Verbündeten des Feindes – sie liegen vor dem Eroberer. Die hinter ihm liegenden Heere werden gleichfalls in die durch ihre Lage zur Feindschaft verurteilten, die durch ihre Lage zur Freundschaft befähigten und die neutralen differenziert. Zwanzig Kategorien werden aufgezählt für die Mächte, mit denen kein Vertrag möglich ist; fünf Klassen von Feindschaft existieren; vier Voraussetzungen werden genannt, die einen Krieg ratsam erscheinen lassen. Aber es wird auch zu bedenken gegeben: Niemand ist nur aus sich heraus Freund oder Feind. Es gibt immer einen Grund; auch ein Verbündeter kann zum Feind werden. Das Agnipurana war ein ganz auf die Liturgie praktischer Gottesverehrung ausgerichtetes Buch; deshalb berührte es sonderbar, daß Priester, heilige Asketen und Astrologen beim Kampf gegen den Feind im Sinne der lächelnden römischen Auguren hinzuzuziehen waren, mit erdichteten Weissagungen, die den Feind entmutigen sollten. Es lag nahe, die Muster dieser Sammlung auch auf die europäischen Verhältnisse anzuwenden; die Kämpfe des Abendlands, in denen es für unser Verständnis immer auch um die Durchsetzung kultureller Prinzipien ging, erschienen unversehens in kälterem Licht, wurden zu physikalischen Vorgängen, Dynamiken zwischen Kräften und Gegenkräften – Feindschaft ohne Haß, beinahe ohne Emotion, Krieg und Frieden gleichsam als Ein- und Ausatmen. Ein fahles Element der Ehrsucht brachte nur das Schicksal der Frauen ins Kriegstheater; es mochte sich aber erst in den Kämpfen mit den islamischen Moguln so verschlimmert haben. Mein Gastgeber sprach stolz von den Hunderten Frauen, die vor Eroberung der Festung Chittorgharh auf einen riesigen Scheiterhaufen gesprungen waren, um sich dem Zugriff der Eroberer zu entziehen. Und auch das mit Miniaturen im persischen Stil erlesen geschmückte Empfangszimmer seiner eigenen Festung besaß ein grausiges Geheimnis. Hinter der Marmorwand war die Ehefrau eines Monarchen, vom Feind geraubt, in einen fremden Harem verschleppt und schließlich daraus wieder befreit, bei lebendigem Leibe eingemauert worden.
[...]
SINN UND FORM 1/2014, S. 5-9