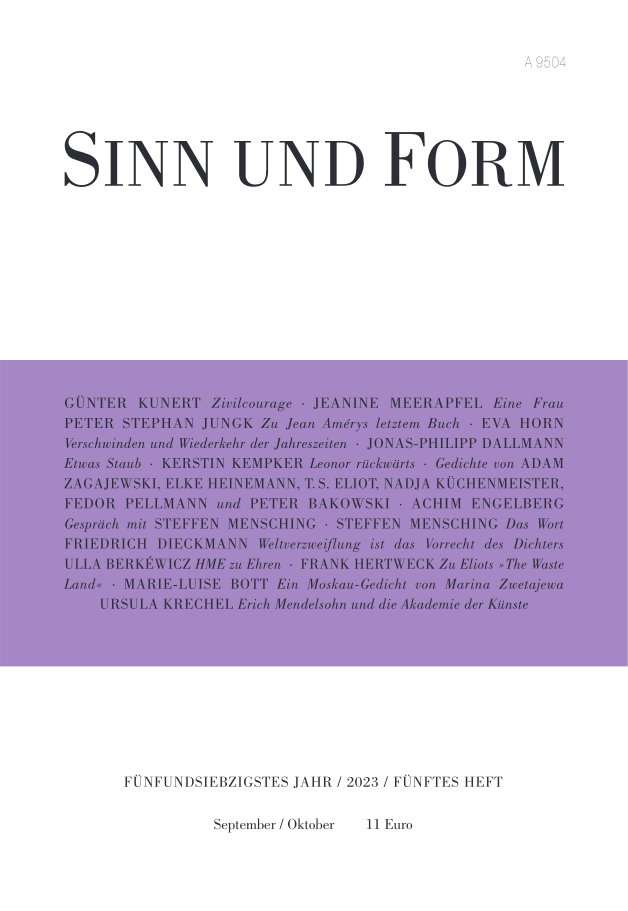
[€ 11.00] ISBN 978-3-943297-73-7
Printausgabe bestellen[€ 8,00]
PDF-Ausgabe kaufenPDF-Download für Abonnenten Sie haben noch kein digitales Abo abgeschlossen?
Mit einem digitalen Abo erhalten Sie Zugriff auf das PDF-Download-Archiv aller Ausgaben von 2019 bis heute.
Digital-Abo • 45 €/Jahr
Mit einem gültigen Print-Abo:
Digital-Zusatzabo • 10 €/Jahr
Leseprobe aus Heft 5/2023
Horn, Eva
Das Ende des Frühjahrs. Verschwinden und Wiederkehr der Jahreszeiten
Wer heute »vier Jahreszeiten« googelt, findet entweder Vivaldi oder eine Hotelkette, schlimmstenfalls auch noch ein paar handgestrickte Gedichte oder Bildmotive mit fallenden Blättern. Jahreszeiten sind banal wie Wettergespräche, peinlich wie die Rede vom »Wonnemonat Mai«, langweilig wie alles, was so erwartbar ist wie Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Gelegentlich ist die Rede von untypischen Jahreszeiten, aber das ist mittlerweile so unoriginell wie der Reflex, jedes schlechte Wetter auf den Klimawandel zu schieben. Immerhin hat es der Frühling im Sommer 2022 mal in die Nachrichten geschafft. Zwei Mitglieder der italienischen »Letzten Generation« hatten sich in den Uffizien an ein Kunstwerk geklebt, das nicht besser gewählt sein konnte: Sandro Botticellis »Primavera«.
Botticellis Bild ist die wohl bekannteste Jahreszeiten-Allegorie, die je gemalt wurde. Im Zentrum steht Venus, die Göttin der Liebe, auf einem blumenübersäten Rasen in einem Orangenhain, neben der Gruppe der drei tanzenden Grazien. Rechts verfolgt der Westwind Zephyr die Nymphe Chloris, die sich, nach Ovid, in die Göttin Flora verwandelt, die blumengeschmückte Frauenfigur im Vordergrund. Flora ist eine der Vegetationsgottheiten, mit Hilfe des Windgotts bewirkt sie das Austreiben und Blühen der Pflanzen im Frühjahr. Links steht Merkur und schiebt mit seinem Stab dunkle Wolken zur Seite. Was das Gemälde aus dem 15. Jahrhundert zeigt, ist Klima – und insofern eine passende Folie für die Klimagerechtigkeitsbewegung.
Vielleicht aber gerade deshalb, weil Botticellis Bild eine Idee von Klima und Natur vorführt, die von unserer heutigen Vorstellung denkbar weit entfernt ist. Es ist eine anthropomorphe Natur, deren Kräfte durch Götter und Göttinnen verkörpert werden, über deren Köpfen ein kleiner, blinder Amor schwebt. Liebe regiert die Natur. Nicht zufällig ist der Schauplatz ein Hain von Orangenbäumen, die zugleich Blüten und Früchte tragen. Botticellis Frühlingsbild zeigt nicht allein den Frühling, sondern, ganz grundsätzlich, eine pulsierende Natur, die in Zyklen und Phasen organisiert ist, Natur als Wandel und ewige Wiederholung.
Heute leuchtet uns gerade noch die Assoziation von Frühling, Naturerwachen, jugendlicher Grazie und Liebe ein. Gelegentlich reden wir von erotischen Anwandlungen als »Frühlingsgefühlen«, aber im Grunde sind die Jahreszeiten längst dem Verdikt des Kitsches verfallen. Dabei waren sie einmal ein zentrales Thema der Literatur, der Kunst und Musik, von Hesiods »Werken und Tagen« über Ovids »Metamorphosen« bis zu dem Langgedicht »The Seasons« (1726 – 30) des Schotten James Thomson, das zur Vorlage für Haydns Jahreszeiten-Oratorium (1801) wurde. Nicht zu vergessen natürlich Vivaldis Violinkonzerte (1725), denen man heute in jeder Telefonwarteschleife lauschen darf, Poussins letzter Gemäldezyklus »Les saisons« (1660 – 64) und Hölderlins späte und rätselhafte Scardanelli-Gedichte (ca. 1807 – 43). Immer noch schön sind Rilkes Winterstimmungen und Herbstgleichnisse. Und auch Peter Maffay hat 2011 eine Art Kinderlied zum Thema beigesteuert. Von der Renaissance bis zur Aufklärung schmückten die Jahreszeiten Gobelins, Gebäude, Möbel, sie inspirierten Musik, sie strukturierten Almanache und Gesundheitsratgeber. Aber was waren sie, bevor sie zu Hotelketten und Kitschmotiven herabsanken?
Jahreszeiten gaben den Takt des Lebens vor, indem sie die Rhythmen der Natur mit den Zeitmodellen des Menschen verbanden. Die Zeit der Natur ist zyklisch, mit diesem regelmäßigen Takt vermittelt sie einen Sinn für den richtigen Moment: »Halte die Maße ein, denn alles hat seine Stunde«, heißt es bei Hesiod. Und dabei geht es nicht nur um Aussaat oder Seefahrt, sondern auch ums Heiraten, Geschäftemachen, Häuserbauen. Alles menschliche Handeln muß seinen rechten Zeitpunkt finden, wie es im Alten Testament heißt: »Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde: geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit, pflanzen hat seine Zeit, ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit …« (Pred. 3,1) Die Maße dieser Naturzeit einzuhalten heißt den richtigen Moment, den Kairos abwarten zu können, kommen zu sehen und zu ergreifen. Es heißt, ein Zeitmaß zu respektieren, das nicht einfach eines der menschlichen Entscheidungen ist.
Die zyklische Zeit bedeutet aber auch, immer wieder neu anfangen zu können, Schuld und Schulden zu vergeben. Der Neubeginn jedes Jahres (traditionell eher am Frühlingsanfang als in der dunkelsten Zeit des Jahres, dem heutigen Neujahr) bedeutet auch einen Neubeginn der Gemeinschaft. »Anläßlich dieses Zeiteinschnitts, den das ›Jahr‹ bedeutet, erleben wir (…) die Vernichtung des vergangenen Jahres (…), eine Annullierung der Sünden und Fehler des Individuums und der Gemeinschaft im ganzen«, schreibt Mircea Eliade. Die Rituale des Jahresanfangs stellen »die mythische und primordiale Zeit wieder her (…), die ›reine‹ Zeit, die Zeit, die im ›Augenblick‹ der Schöpfung war«. Genau das, so scheint es, ist die heimliche Bedeutung von Frühlingsfesten, Sommersonnenwenden oder auch des dunkelsten Tages im Jahr: Weihnachten, welches das Konzil von Nicäa 325 listig auf den heidnischen Feiertag des Sol Invictus – der unbesiegt wiederkehrenden Sonne – legte.
Die Kultur der Jahreszeiten zielt darauf, menschliche Kultur mit der zyklischen Zeit der Natur in Einklang zu bringen. Und zwar gerade deshalb, weil die menschliche Zeit eine andere Form hat als die sich immer wieder regenerierende Natur. Menschen wachsen, altern, sterben, sie akkumulieren und verlieren unwiederbringlich. Ihre Zeit ist linear und irreversibel, stagnierend oder sprunghaft, leer oder voll. Natürliche Zeit dagegen ist pulsierend, zirkulär, regelmäßig, und damit in gewissem Sinne endlos. Die Zeit der Natur ist Ausdruck einer kosmischen Ordnung, die man berechnen kann; die Zeit des Menschen ist unregelmäßig, hoffnungslos verstreichend, stets zu kurz. Der Tod ist ein Ende, der Untergang in der Natur die Rückkehr in einen ewigen Zyklus von Materie: Omnia mutantur, nihil interit. Alles verändert sich, nichts geht zugrunde, schreibt Ovid in den »Metamorphosen«. So ist die intensive kulturelle Anverwandlung dieser Rhythmen durch Feiertage der Versuch, an dieser Ordnung der Natur teilzuhaben.
Darum werden Jahreszeiten mit kultureller Bedeutung aufgeladen: der Frühling mit Jugend, Liebe und Aufbruch, der Sommer mit dem Höhepunkt des Lebens, Energie und Freude, aber auch Arbeit und Anstrengung, der Herbst mit Verfall und Melancholie, aber auch mit Ernte, Reife und Zufriedenheit, der Winter schließlich mit Zerstörung oder Tod, aber auch mit einer Fülle von Festen. So ist der Winter die vielleicht ambivalenteste Jahreszeit: Es ist die Zeit des schlechten Wetters, der Not und Tristesse, aber auch der Innenräume, des Zusammenkommens, der Lichterfeste und sozialen Wärme. Bezeichnend ist, daß gerade das Barock, das unter den eisigen und langen Wintern der »Kleinen Eiszeit« litt, den Winter mit seinen langen Nächten auch als Zeit erotischer Aktivitäten zu feiern wußte. Johann Christian Günther schwärmt unzweideutig: »Der Schönen in den Armen liegen, / Wenn draußen Nord und Regen pfeifft, / Macht so ein inniglich Vergnügen«.
Insgesamt ist der Zyklus der vier Jahreszeiten nicht selten ein Anlaß, über das Verhältnis von menschlicher Geschichte und anderen Formen der Zeit nachzudenken. So malt Nicolas Poussin zwischen 1660 und 1664 die Jahreszeiten als eine Serie von biblischen Szenen, die verschiedene Episoden des Alten Testaments zugleich im Licht verschiedener Jahres- und Tageszeiten präsentieren. Das Frühlingsbild zeigt das Paradies am Morgen, der Sommer die Begegnung von Ruth und Boas auf dem Erntefeld mittags, der Herbst die Rückkehr der Kundschafter aus dem Gelobten Land am Nachmittag, der Winter die Sintflut in einer blitzdurchzuckten Nacht. Die Zyklen der Natur bilden hier den Rahmen für menschliches Handeln. So faltet Poussin die Geschichte des Volkes Israel in eine Geschichte der Natur zwischen Paradiesgarten, Kairos, Hoffnung und Katastrophe ein. Bemerkenswert ist, daß die Schlange im Paradiesbild fehlt, aber dafür untypisch im Winterbild der Sintflut auftaucht. Das Ende verweist zurück auf den Sündenfall des Anfangs. Aber, so weiß man, nach dem Winter der Sintflut folgt gleichwohl ein Neuanfang. Das zeigt eine andere Seite der zyklischen Zeitform. Sie kann viele verschiedene Arten von Zeit integrieren: menschliche Geschichte mit ihrer linearen Zeitlichkeit, die Zyklen der Jahres- und Tageszeiten, den Kairos des richtigen Augenblicks, aber auch den Einbruch einer Zeit Gottes, die der menschlichen Zeit Anfang und Ende setzt.
(…)
SINN UND FORM 5/2023, S. 633-640, hier S. 633-636
